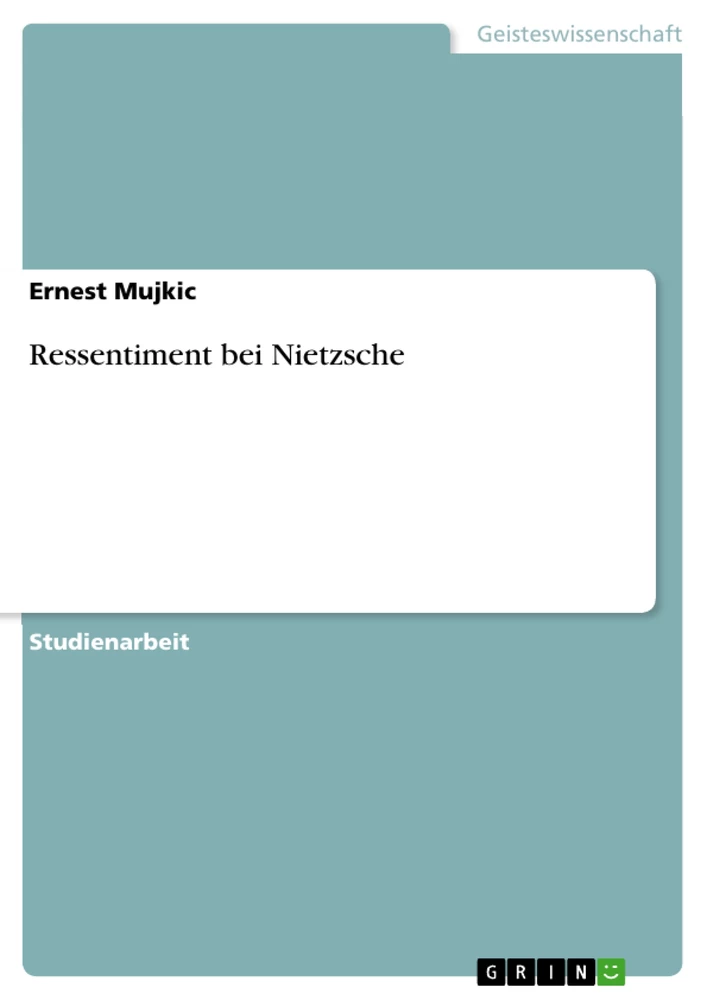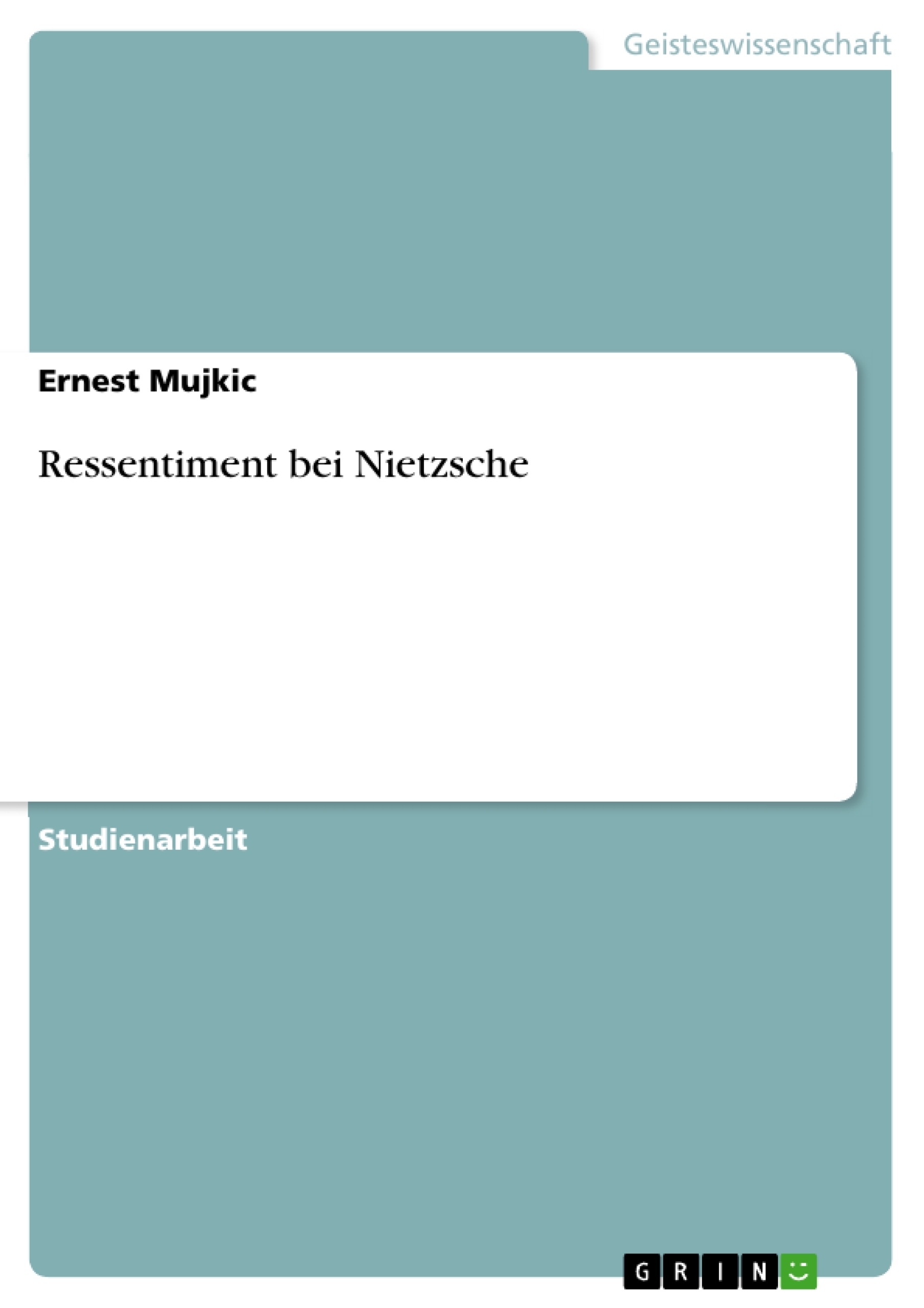Im Folgenden wird der Versuch unternommen zu prüfen, inwiefern die Ausführungen Friedrich Nietzsches zum Ressentiment vereinbar sind mit der These, dass das Ressentiment ein dem Gerechtigkeitssinn innewohnendes Moment in Funktion des Gleichheitsindikators ist. Ausgehend von Nietzsches Ausführungen zum Ressentiment in der Ersten Abhandlung seiner Schrift Zur Genealogie der Moral wird 1. Nietzsches Verständnis vom Ressentiment, sowie 2. die Gleichbehandlung bzw. Ungleichbehandlung als ein Motiv des Ressentiments dargestellt. Im Anschluss daran folgt 3. eine Untersuchung der Typologisierung des von Nietzsche bestimmten Ressentimentträgers.
Die thematische Schwerpunktlegung dieser Arbeit auf eine Verbindung des Ressentiment mit der Ungleichbehandlung unter besonderer Berücksichtigung der einzelnen Charaktermomente des Ressentimentträgers, liegt zu einem Teil darin begründet, dass in der wissenschaftlichen Aufarbeitung des Ressentiment bei Nietzsche dieser Aspekt stets negiert wird, ohne eine stärkere Erläuterung der Ursachen und Folgen des Ressentiment in Verbindung mit den einzelnen Charaktermomenten des Ressentimentträgers. Zum anderen soll mit dieser Arbeit der Versuch unternommen werden, das Ressentiment bei Nietzsche in Bezug auf seine Vereinbarkeit mit der Gerechtigkeit zu erläutern.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Das Ressentiment
3. Das Ressentiment und die Ungleichbehandlung
4. Der Ressentimentträger
4.1 Der Sklave
4.2 Der Schwache
4.3 Der Gemeine
5. Fazit
6. Literatur