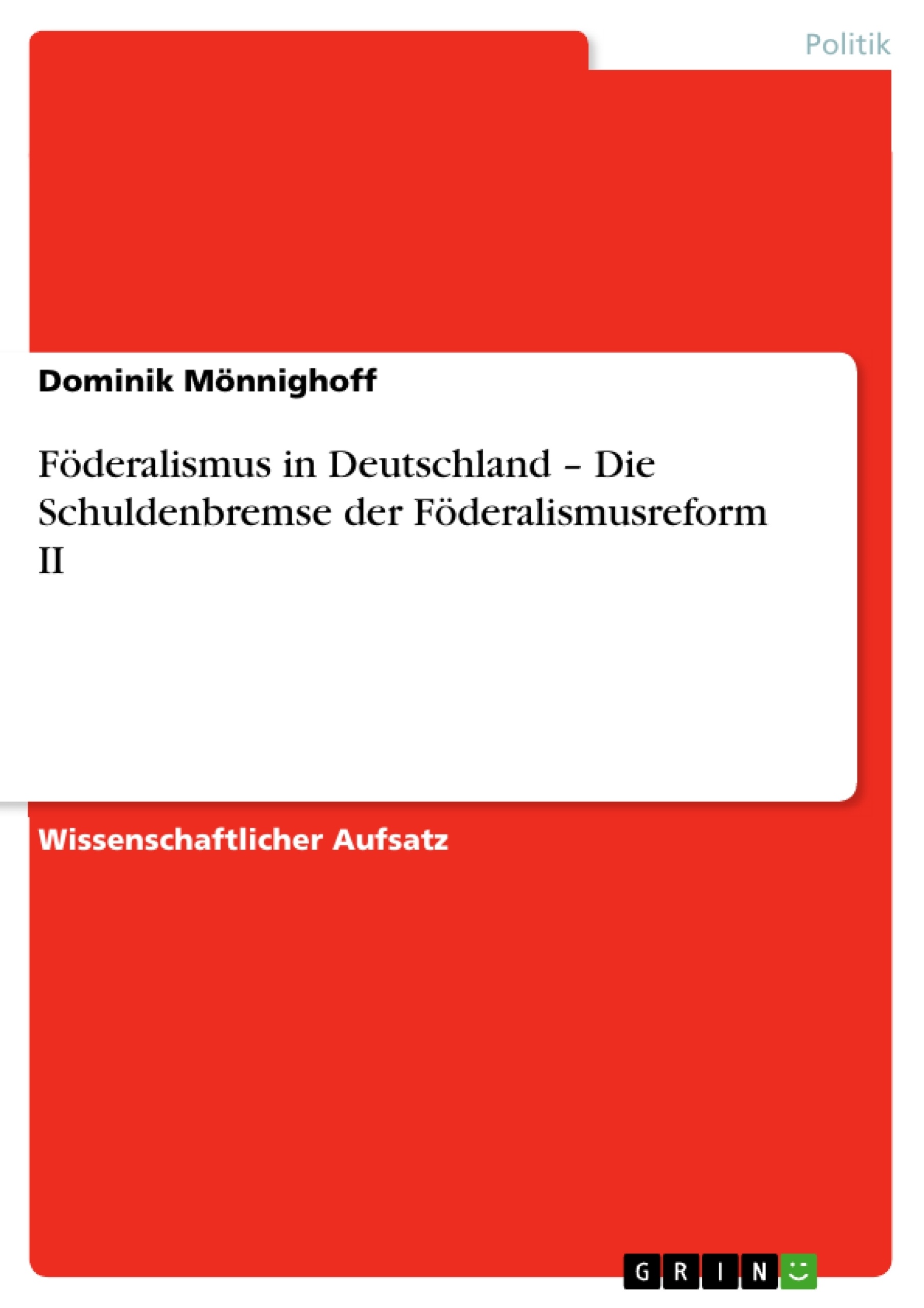These: „Die eingehenden Gesetzesänderungen im Zuge der Föderalismusreform II sind verfassungsrechtlich zweifelhaft und schwächen die Stellung der Landesparlamente.“
Die Staatsverschuldung in der Bundesrepublik Deutschland ist seit nunmehr 60 Jahren von einem Anfangswert von 10 Milliarden Euro 1950 auf 2036 Milliarden Euro im Jahre 2010 gestiegen. Mit der Verabschiedung der Föderalismusreform II sollte eine Finanzreform durchgeführt werden, die sich in Anbetracht der stetig steigenden Staatsschulden gerade auf den Stopp der Schulden konzentriert und in der Föderalismusreform I gar nicht thematisiert worden war. Noch im Dezember 2006 wurde aus diesem Grund von den Fraktionen der CDU/CSU, der SPD und der FDP im Bundestag eine Kommission zur Modernisierung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen beantragt. Aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen für die Wachstums- und Beschäftigungspolitik innerhalb und außerhalb Deutschlands war die Themensammlung für die Reform der Bund-Länder-Finanzbeziehungen vielfältig. Insbesondere stand die Haushaltswirtschaft allgemein im Vordergrund. Es sollten Frühwarnsysteme zur Vorbeugung von Haushaltskrisen geschaffen und Konzepte für die Bewältigung bereits bestehender Haushaltskrisen erarbeitet werden. Um einer besseren Aufgabenerfüllung nachzukommen, sollte durch eine Entbürokratisierung eine Effizienzsteigerung realisiert werden. Besonderes Augenmerk lag zudem auf der Stärkung der Eigenverantwortung der Gebietskörperschaften und ihrer aufgabenadäquaten Finanzausstattung. Jedoch verkündete die Föderalismuskommission direkt mit der Bekanntgabe, dass man nicht für alle Themen eine Lösung hat finden können, relativierend jedoch sagte, dass man mit dem Erreichten Zufrieden sein müsste.
Mit der Einführung der Schuldenbremse sollte ein effizientes Mittel geschaffen werden, die Neuverschuldung verfassungsrechtlich zu verhindern. Die neuen Bund-Länder-Finanzbeziehungen lassen jedoch auch die Frage offen, ob diese Aufteilung nicht das Subsidiaritätsprinzip verletzt. Einerseits ist die Begrenzung der Staatsverschuldung kein Föderalismusthema. Andererseits umfasst die Staatsverschuldung natürlich nicht nur die Schulden des Bundes, sondern auch die der Länder, Kommunen und der Sozialversicherungen.
Föderalismus in Deutschland – Die Schuldenbremse der Föderalismusreform II
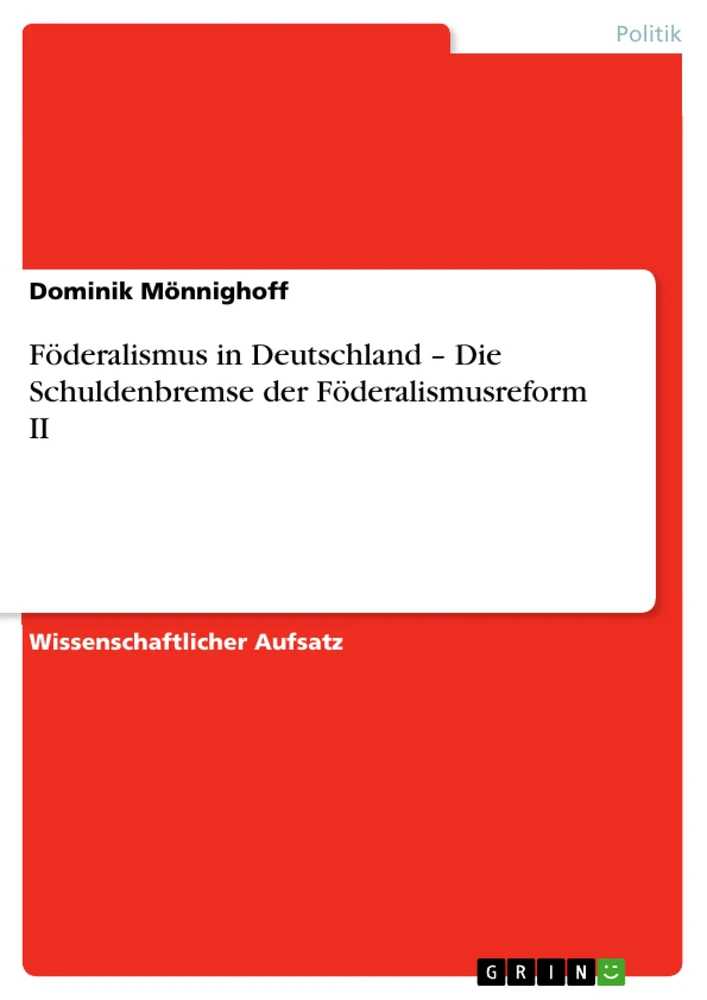
Wissenschaftlicher Aufsatz , 2011 , 6 Seiten
Autor:in: Dominik Mönnighoff (Autor:in)
Politik - Politisches System Deutschlands
Leseprobe & Details Blick ins Buch