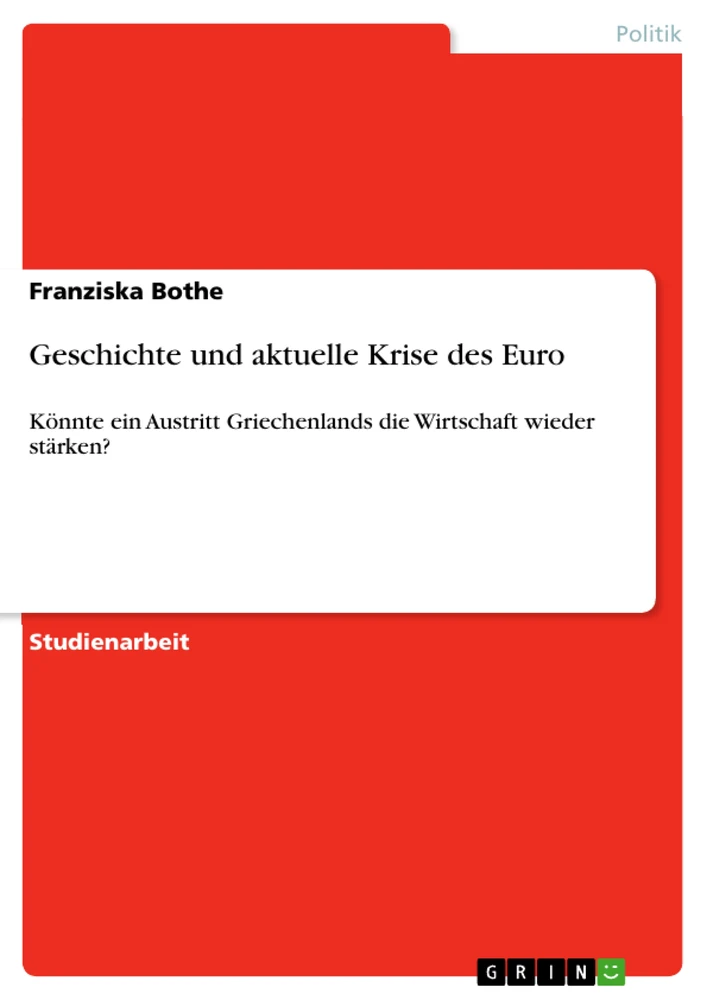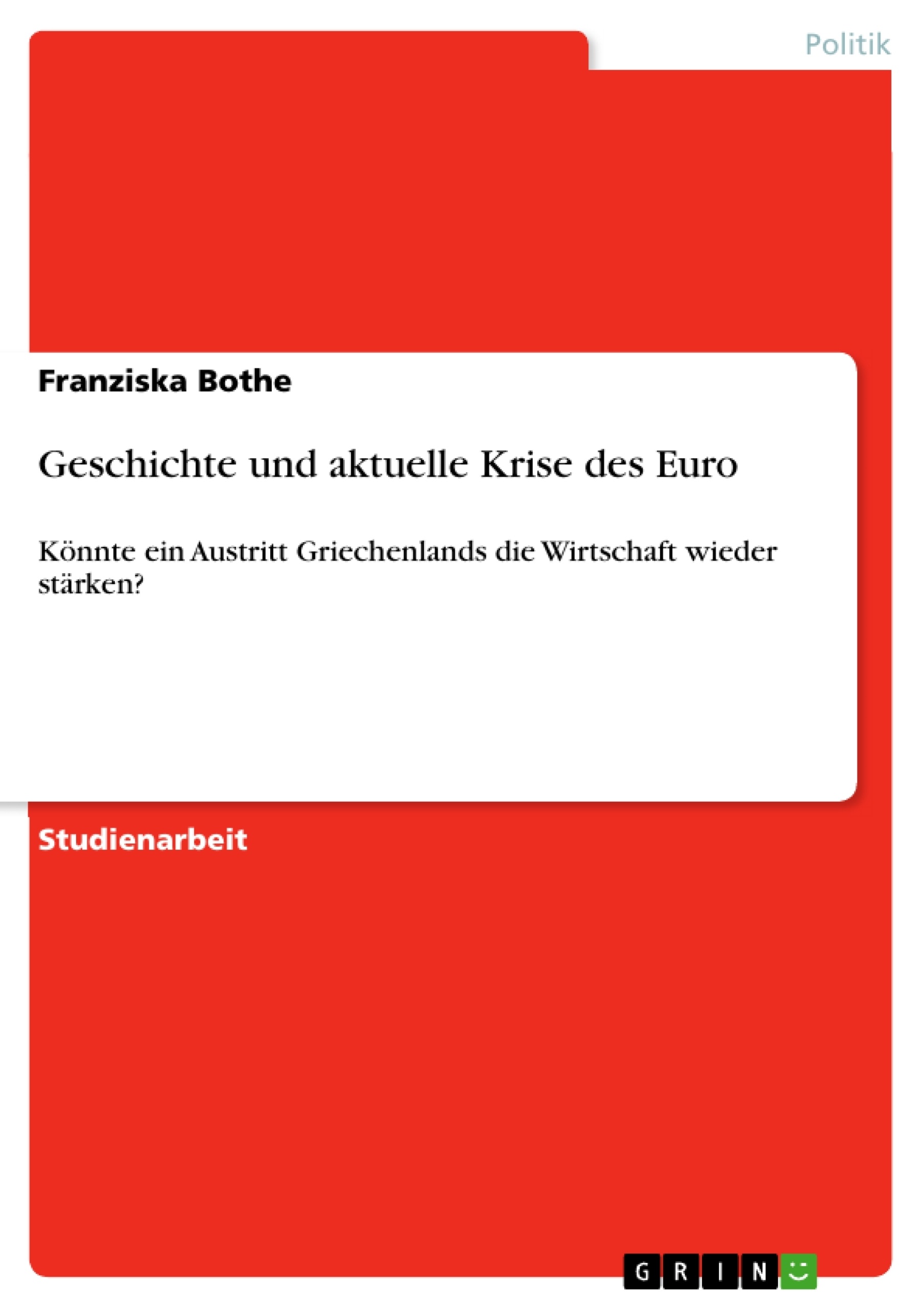Durch die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU), die Ende der 1980er Jahre gegründet wurde, konnte die Einführung einer gemeinsamen Währung in Europa ermöglicht werden. Der Euro sollte einen einheitlichen Wirtschaftsraum schaffen und die Wettbewerbsfähigkeit Europas stärken. Im Jahr 2010 jedoch gerieten sowohl die Stabilität als auch das wirtschaftliche Wachstum der Mitgliedstaaten in Gefahr, was zu einer europäischen Staatsschuldenkrise führte. Der Grund hierfür lag vor allem in der griechischen Finanzkrise. Griechenland hatte sich mit Hilfe einer Bilanzfälschung den Beitritt zur Euro-Zone erschlichen und war nicht mehr in der Lage, bereits fällige Schulden zurückzuzahlen. Weitere Länder mit hohem Verschuldungsgrad sind Irland, Italien, Portugal und Spanien, die ebenfalls nicht mehr im Stande sind, ihre Schulden eigenständig zu begleichen. Als am höchsten verschuldeter Krisen-Staat, stellt sich die Frage, ob ein Ausstieg Griechenlands aus der Euro-Zone ökonomisch sinnvoll wäre oder ob dadurch weitere wirtschaftliche Schäden hervorgerufen würden.
Gliederung
1. Einleitung
2. Geschichte des Euro
3. EU und Euro-Zone in Zahlen
4. Aufgaben der Europäischen Zentralbank
5. Ökonomische Auswirkungen
5.1 Chancen
5.2 Risiken
5.3 Inflationsentwicklung in Deutschland
5.3.1 Gefühlte und gemessene Verteuerung
6. Akzeptanz des Euro in Deutschland
7. Griechenland in der Finanzkrise
7.1 Ursachen für die Krise
7.2 Folgen der Krise für die deutsche Konjunktur
7.3 Neuestes Kreditpaket vom 21. Juli 2011
7.4 Gefahr einer Transferunion
7.5 Folgen eines Austritts aus der Euro-Zone
8. Fazit
9. Literaturverzeichnis