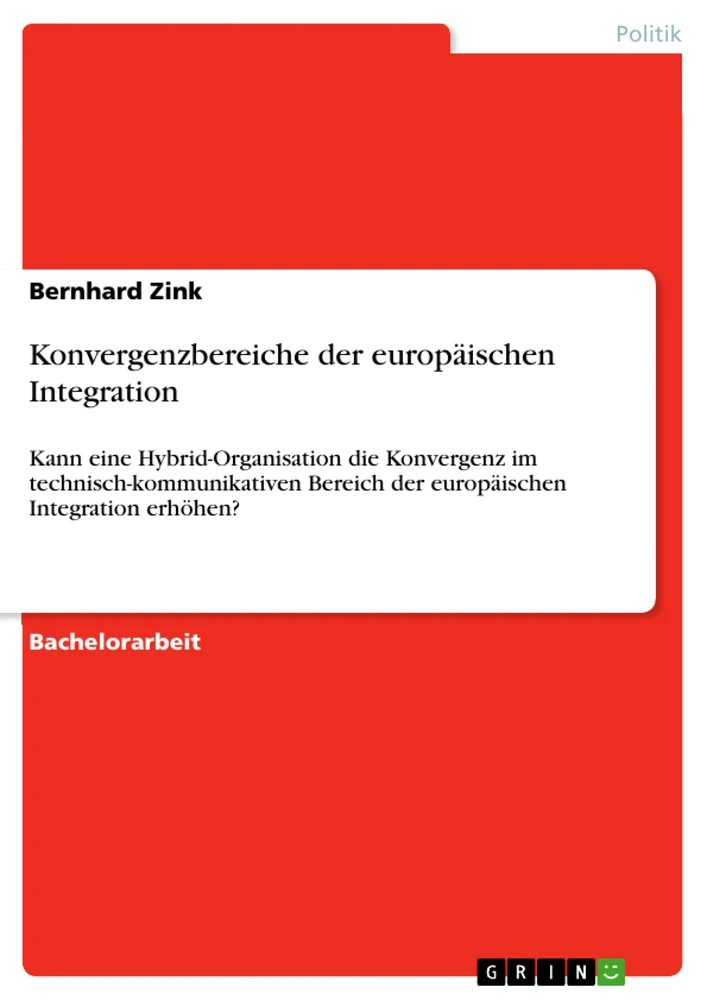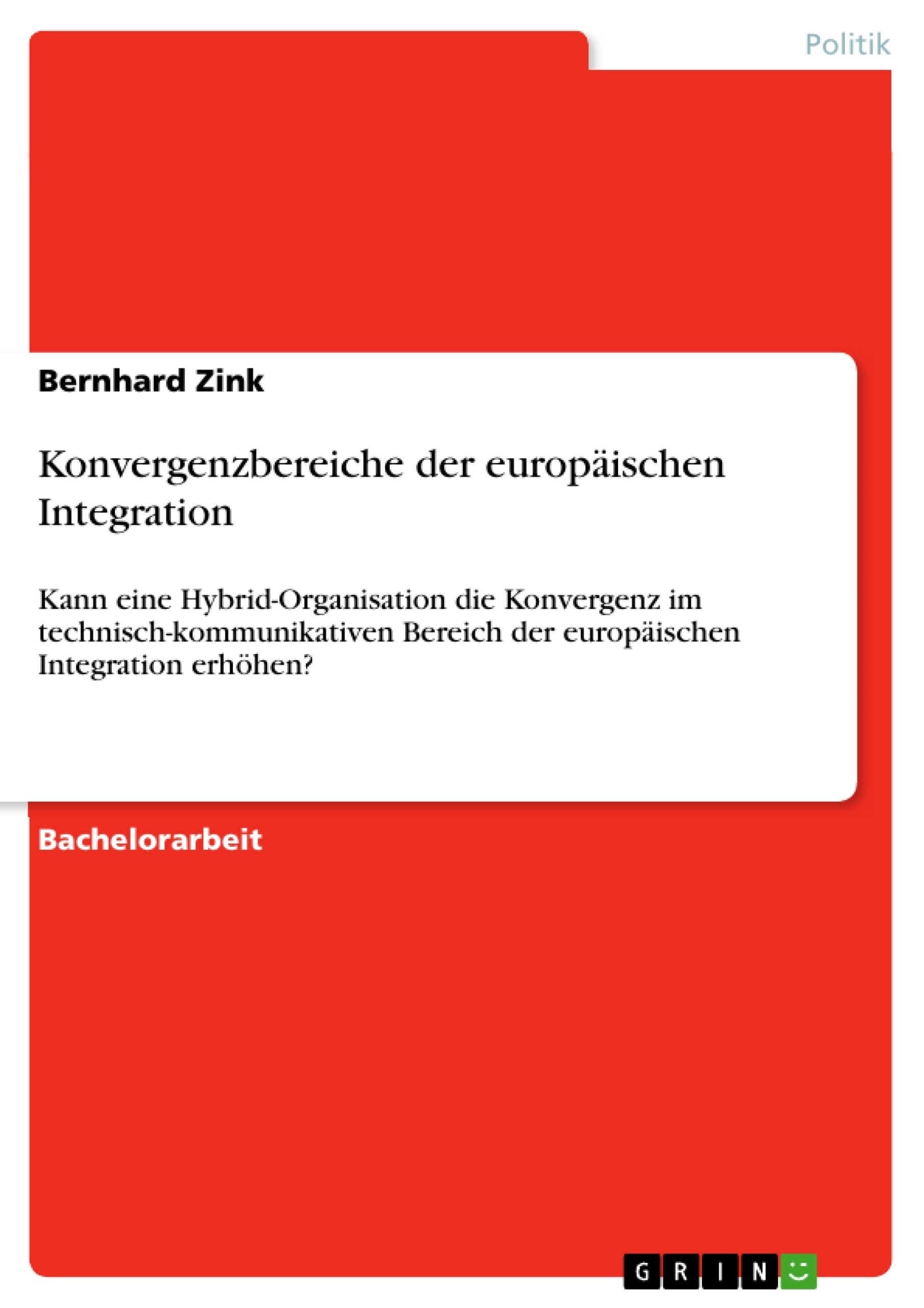Die EU ringt angesichts der aktuellen Probleme rund um die Währungsunion um ihr Leben. Scheinbar über Nacht werden demokratisch gewählte Regierungen durch Expertengremien ersetzt. Gleichzeitig bleibt die Politik in den nationalen als auch in den europäischen Gremien den zunehmend verunsicherten und wütenden Bürgern Antworten schuldig. Durch die steigenden Transferzahlungen sinkt die Loyalitätsbereitschaft unter den Mitgliedsstaaten der Union. Diese Arbeit zeigt einerseits warum diese Loyalitätsbereitschaft zunehmend sinkt und andererseits was dagegen getan werden könnte.
INHALTSVERZEICHNIS:
1. Zur Lage der EU
2. Das Forschungsdesign
3. Steht die europäische Integration still?
4. Welche Auswirkungen hat die geringe Konvergenz im technisch-kommunikativen Bereich auf die europäische Integration?
5. Warum verhindern das repräsentativ-liberale und das deliberative Demokratiemodell die Erhöhung der Konvergenz im technisch-kommunikativen Bereich der europäischen Integration?
6. Kann eine Hybrid-Organisation durch die Anwendung von Public-Affairs-Management die Konvergenz im technisch-kommunikativen Bereich der europäischen Integration erhöhen?
7. Die Zukunft der europäischen Integration ist abhängig von den Europäern und Europäerinnen
8. Literaturverzeichnis
9. Abbildungsverzeichnis