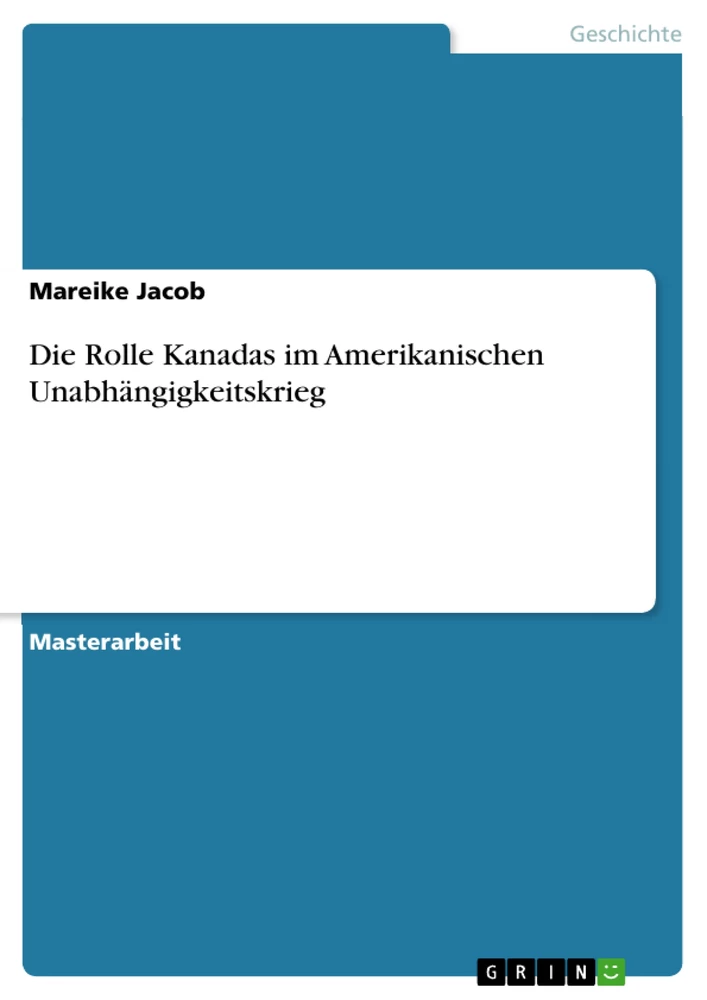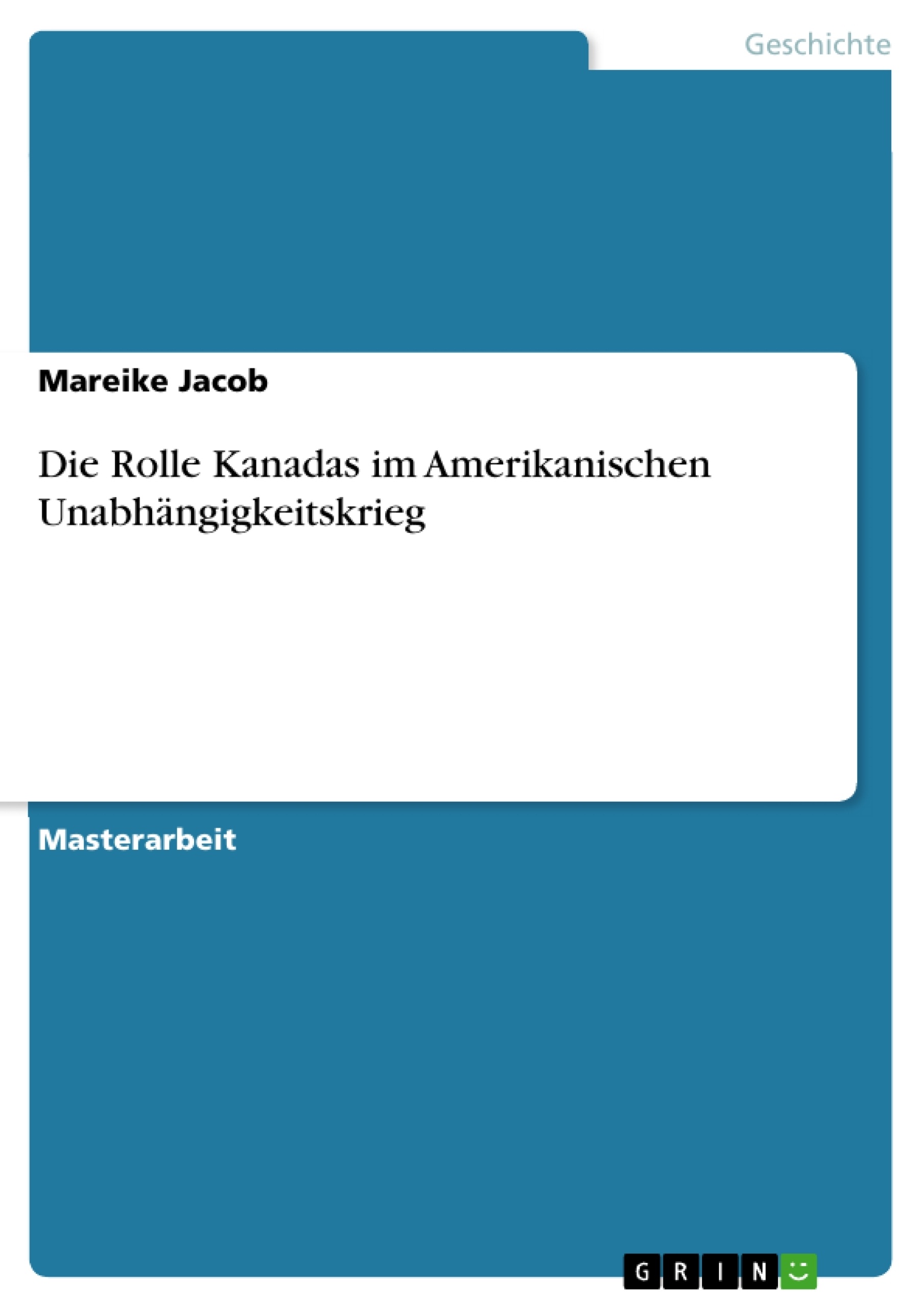Unbestreitbar ist die Geschichte Kanadas eng mit der Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika verknüpft: Als „bad neighbors“ teilten Beide nicht nur eine gemeinsame Geschichte, ähnliche Profile und eine geografische, wirtschaftliche und kulturelle Nähe, sondern unterstanden zudem beide der Britischen Krone. Während der Amerikanischen Revolution und damit während des Unabhängigkeitskrieges hat der mächtige Nachbar im Süden versucht, neben den dreizehn amerikanischen Gründungsstaaten auch die Gebiete des heutigen Kanadas in das neue Staatengebilde einzubinden.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit eben dieser Phase, dem Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Sie will jedoch den Fokus nicht auf die oft bedachte und in der Forschung breit diskutierte amerikanische, sondern auf die oft nur am Rande betrachtete kanadische Situation legen. Hier soll insbesondere die Rolle, die Kanada in diesem amerikanisch–britischen Krieg zukommt, untersucht werden. Es soll folglich herausgearbeitet werden, welche Bedeutung den kanadischen Kolonien in Hinblick auf die Ereignisse, v. a. aber Folgen des Amerikanischen Unabhängigkeitskrieges zugesprochen werden kann.
Die vorliegende Arbeit teilt sich der Übersichtlichkeit halber sowie den inhaltlichen Zusammenhängen logisch folgend in drei größere Abschnitte: Zum einen die Untersuchung der Vorkriegsphase mit einer Bedingungsanalyse in Kapitel 2; zum anderen die eigentlichen Kriegsjahre 1775–1783 mit der Untersuchung von Loyalitäten, militärischen Bewegungen und Konsequenzen in Kapitel 3. Der letzte Teil behandelt in weiteren, gesonderten Kapiteln die Optionen Kanadas als 14. Gründungskolonie der Vereinigten Staaten von Amerika sowie Überlegungen, Kanada als ein Sammelbecken für Loyalisten zu bezeichnen. Auch die Revision des Quebec Acts, dem im Kontext der Amerikanischen Revolution vor allem in Bezug auf die kanadische Beteiligung eine zentrale Bedeutung zukommt, soll untersucht werden. Zudem bietet es sich durch auch heute noch präsente Konkurrenzen und Vergleiche der amerikanischen und kanadischen Nationen an, einmal genauer zu beleuchten, inwiefern sich gemeinsame und unterschiedliche Werte und Prinzipien aus der Revolutionszeit ableiten lassen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Vorkriegsphase
2.1 Die kanadischen Kolonien im Profil
2.2 Die Auswirkungen der Acts seit 1764
2.2.1 Der Quebec Act 1774
3. Die Kriegsjahre 1775 – 1783
3.1 Die Invasion Kanadas
3.2 Weitere Kriegshandlungen im heutigen Kanada
3.3 Der Amerikanische Unabhängigkeitskrieg als Bürgerkrieg
4. Kanada als Sammelbecken der Loyalists
5. Kanada´s Option als 14. Gründungskolonie
6. Der Quebec Act nach 1783
7. Die Entwicklung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden von Kanadiern und Amerikanern durch den Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg
8. Schlussbemerkungen und Fazit
9. Literaturverzeichnis
10. Quellenverzeichnis
11. Internetquellen
12. Weiterführende Literatur