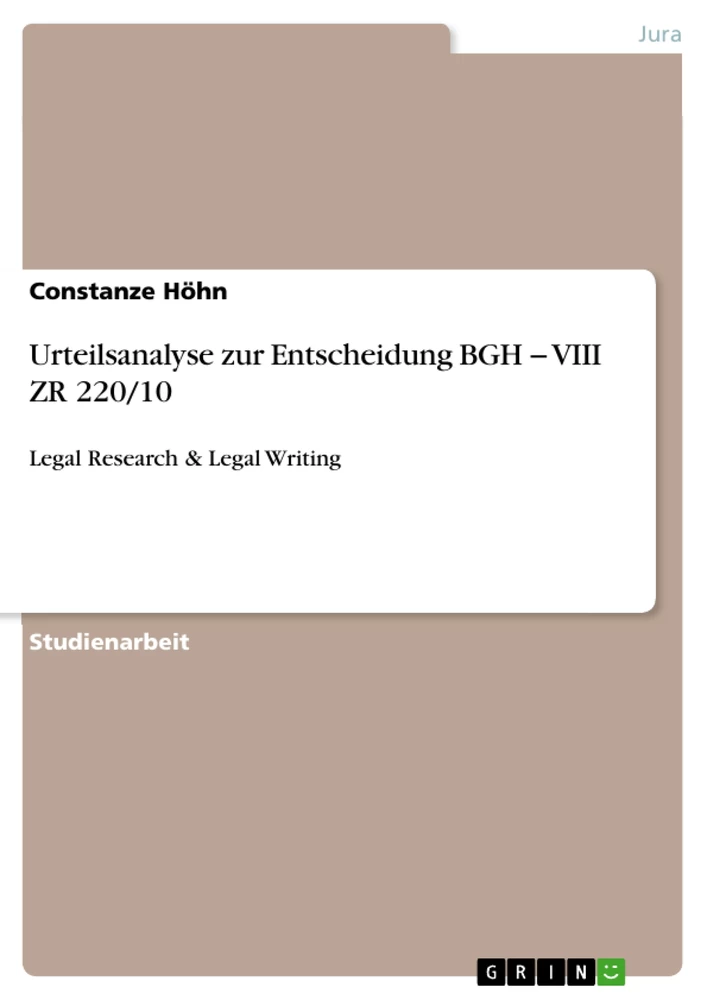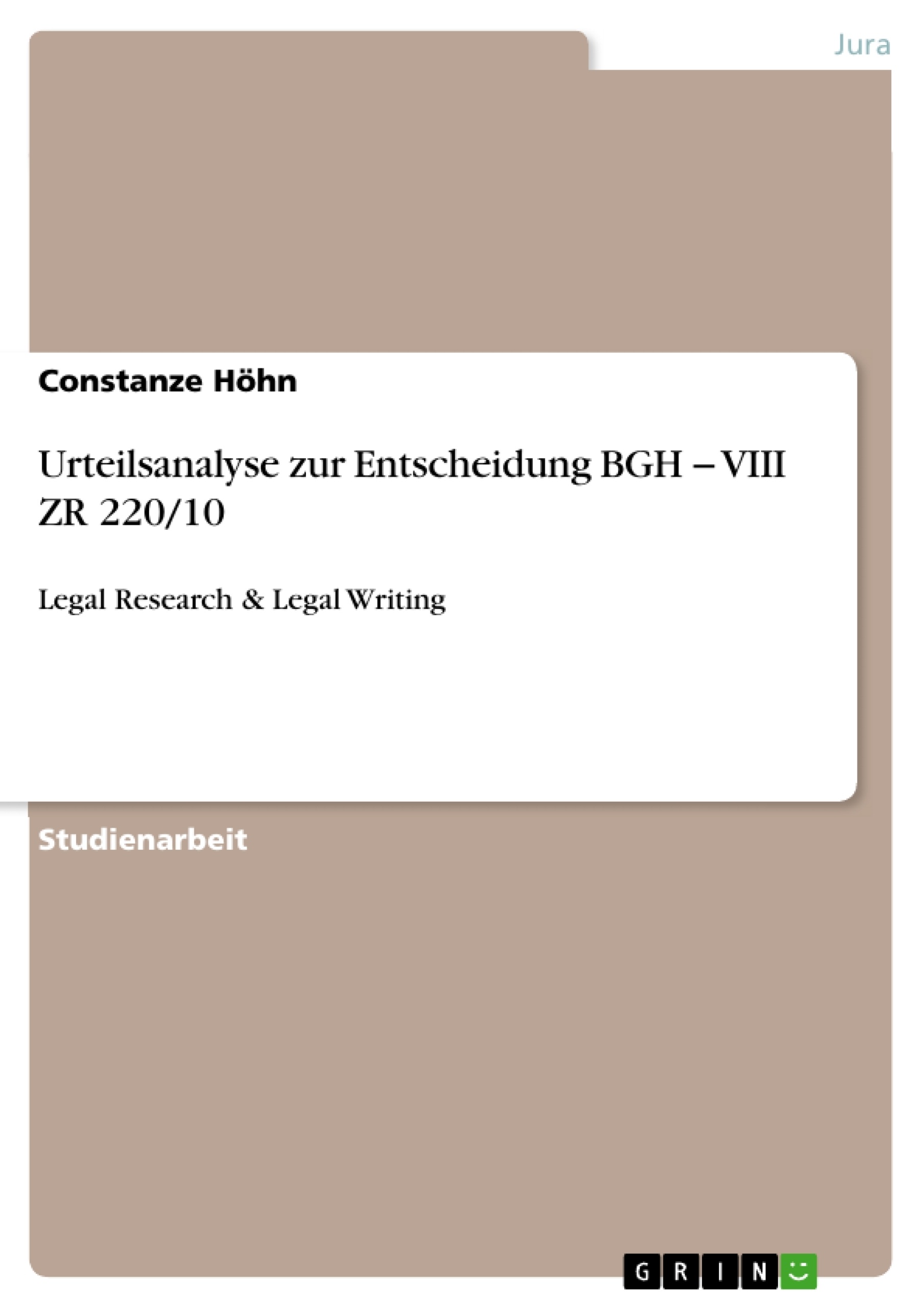Das am 13. April 2011 ergangene Urteil des BGH betrifft die Bestimmung des Erfüllungsortes bei der Nacherfüllung im Kaufrecht und ist die erste höchstrichterliche Entscheidung zu dieser Frage.
Im vorliegenden Fall erwarben die in Frankreich wohnhaften Kläger mit Kaufvertrag vom 23. Februar 2008 bei der in Deutschland ansässigen Beklagten einen neuen Camping-Faltanhänger.
Die Kläger rügten in der Folgezeit verschiedene Mängel und forderten die Beklagte mit Schreiben vom 04. Juni 2008 unter Fristsetzung zum 18. Juni 2008 auf, den Faltanhänger abzuholen und die Mängel zu beseitigen. Ein daraufhin vereinbarter Abholtermin bei den Klägern scheiterte. Mit Schreiben vom 10. Juli 2008 setzten die Kläger der Beklagten erneut eine Frist zur Abholung des Faltanhängers bis zum 14. Juli 2008 und erklärten nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist den Rücktritt vom Kaufvertrag.
(...)
Das zentrale Problem des Falles ist daher die Bestimmung Nacherfüllungsortes im Kaufrecht. Unter Erfüllungsort versteht man denjenigen Ort, an dem der Schuldner die Leistungshandlung vornehmen muss und nicht den Ort, an dem der Leistungserfolg (und damit die Erfüllung im Sinne von § 362 I BGB) eintritt.
Der BGH wies die Klage mit der Begründung ab, dass der Rücktritt, aufgrund der von den Käufern unterlassenen, aber mit Hinweis auf § 269 I BGB, notwendigen Mitwirkungshandlung, nicht wirksam war.
Mit dieser Entscheidung lehnt der BGH die bisher in Rechtsprechung und Literatur vertretenen Hauptauffassungen bezüglich des Nacherfüllungsortes ab und entscheidet sich bei der Bestimmung des Nacherfüllungsortes für den Rückgriff auf die allgemeine Regelung des § 269 I BGB, um interessengerechtere Ergebnisse zu erzielen (A). Ob diese Entscheidung des BGH nun zu mehr Rechtssicherheit bei der Bestimmung des Erfüllungsortes der Nacherfüllung führt, ist jedoch fraglich (B).
Inhaltsverzeichnis
Urteilsanalyse zur Entscheidung BGH − VIII ZR 220/10
A. Eine interessengerechte Lösung für alle Nacherfüllungssituationen
I. Die vorinstanzlichen Entscheidungen : Widerspieglung des Meinungsstreites in Literatur und Rechtssprechung
1. Nacherfüllungsort am Belegenheitsort der Sache
2. Gleichsetzung von Nacherfüllungsort und ursprünglichem Erfüllungsort
3. Vermittelnde Ansicht: variabler Nacherfüllungsort
II. Die BGH-Entscheidung: Eine differenzierte Bestimmung des Nacherfüllungsortes nach den Umständen des Einzelfalls
1. Die Ablehnung der Begründung der vorinstanzlichen Entscheidungen
2. Bestimmung des Nacherfüllungsortes über § 269 I BGB
B. Eine Lösung zu Gunsten der Flexibilität, aber zu Ungunsten der Rechtssicherheit
I. Unsichere Richtlinienkonformität der BGH-Entscheidung
1. Falsche Auslegung des Begriffs „Ersatzlieferung?
2. Tatsächliche Unentgeltlichkeit der Nacherfüllung für den Käufer?
3. Widersprüche zwischen EuGH und BGH in den Entscheidungsgründen
II. Rechtssicherheit nur durch Parteivereinbarung
1. Schwierigkeiten durch die Wertungsentscheidung
2. Folgen für die Praxis
C. Stellungnahme