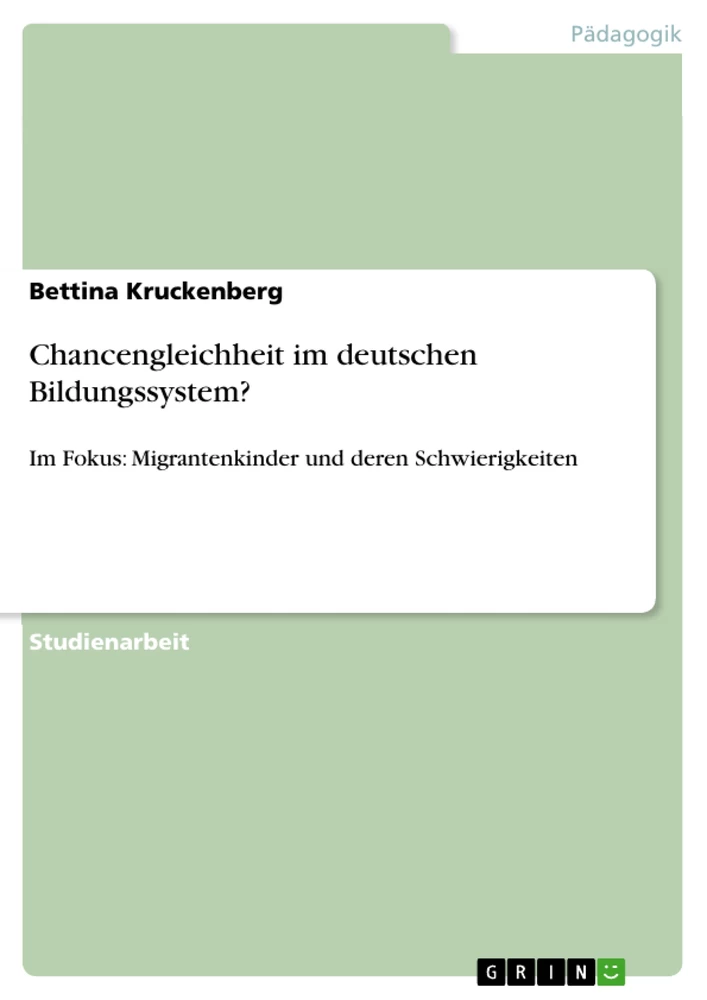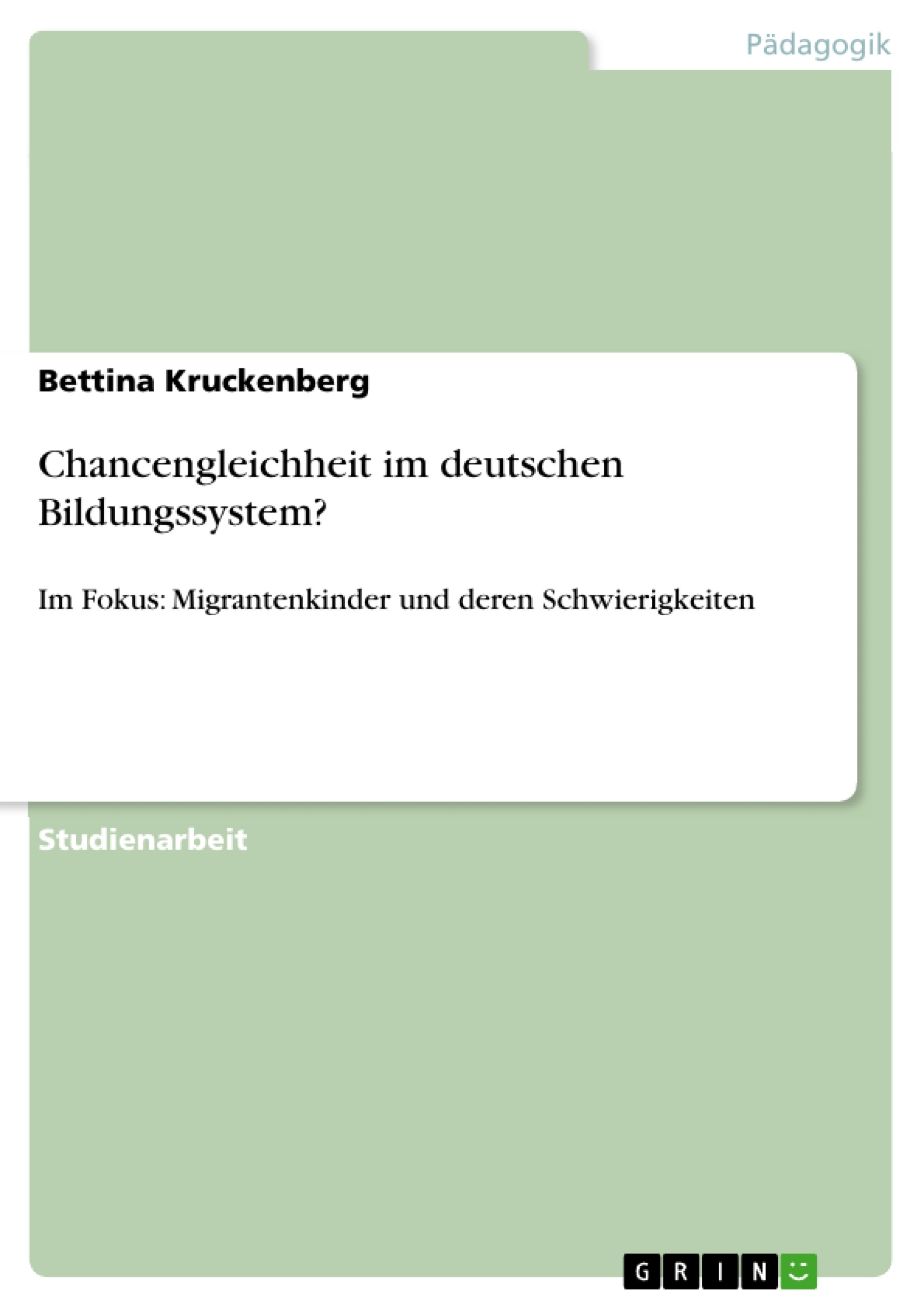1. Einleitung
Die Diskussion um Chancengleichheit im Bildungssystem ist in letzter Zeit wieder neu in der Politik aufgeflammt. Chancengleichheit bedeutet, dass jeder Bürger laut Grundgesetz Recht auf Bildung besitzt, unhabhängig seiner Herkunft oder seines Geschlechts.
Die Realität im Bildungssystem sieht jedoch anders aus. Die Chancengleichheit für alle Bundesbürger ist de jure gesichert, de facto aber nicht gegeben. An der Peripherie der deutschen Gesellschaft hat sich besonders in städtischen Ballungsräumen eine Subkultur entwickelt, die aus Parallelgesellschaften besteht, je nach dem, aus welchen Herkunftsbereichen die Mitglieder stammen. Das Wohngebiet Kreuzberg in Berlin sei als ein Beispiel für die ghettoartigen Wohnbereiche genannt. Diese Subkulturen bilden sich zum Teil aus Migranten, die aus unterschiedlichsten Gründen nicht dazu bereit sind, sich vollständig in die deutsche Gesellschaft zu integrieren. Sie bilden in ihrer Gemeinschaft eigene Vereine, bewegen sich meist nur in ihrem Umfeld, pflegen häufig wenig Kontakt nach außen und sprechen vor allem oftmals nur ihre eigene Sprache. Sie äußern ein Abgrenzungsverhalten, sichtbar an ihrer Kleidung, ihrem Einkaufsverhalten und ihren Treffpunkten, zu denen die einheimische Bevölkerung meist nur eingeschränkten Zugang hat.
Die Kinder aus diesen Gesellschaften sind jedoch trotzdem wie auch deutsche Kinder per Schulgesetz dazu verpflichtet, am deutschen Bildungssystem teilzunehmen. Daraus entwickeln sich oft Probleme, wie zum Beispiel Leistungsschwäche, Schulangst, Schulversagen, Ausgrenzung durch deutsche Mitschüler, Perspektivlosigkeit, Schul- und ausbildungsabbruch. Aggressionen führen meist zu noch mehr Problemen, mehr Ablehnung durch die Mitmenschen und letztendlich zu sozialer Unfähigkeit. Ein wichtiger Auslöser für diese gravierenden Probleme ist die mangelnde Beherrschung der deutschen Sprache, was sich schon im Kindergartenalter oder später bei der Einschulung manifestiert.
All dies wirft eine Reihe von Fragen auf: Wie ist der Status eines Migranten definiert? Welche Integrationsansätze- und möglichkeiten gibt es? Wenn es im Bildungssystem keine Chancengleichheit gibt, wie kann ihr entgegengewirkt werden? Wie sehen die Lösungsansätze und spezielle Fördermaßnahmen bei Sprachdefiziten aus?
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Begriffsdefinition Chancengleichheit
3. Grundsätzliche Überlegungen zum Begriff Migration
3.1. Maßnahmen zur erfolgreichen Integration
3.2. Das Sprachproblem der Migranten
4. Chancengleichheit im deutschen Bildungssystem?
4.1. Die PISA-Studie
4.2. Die IGLU-Studie
5. Lösungsansätze
5.1. Unterstützung des Spracherwerbs durch die Eltern
5.2. Sprachförderungsmaßnahmen in Kindertagesstätten
5.3. Sprachförderung im Übergang Kindergarten - Grundschule
6. Ausblick
Literaturverzeichnis