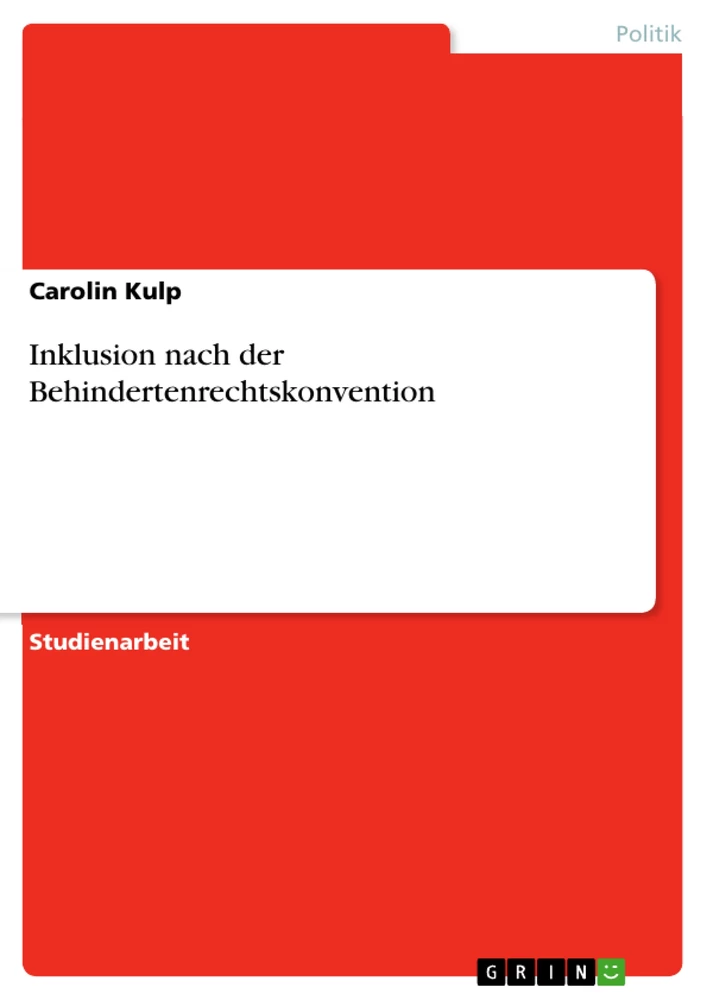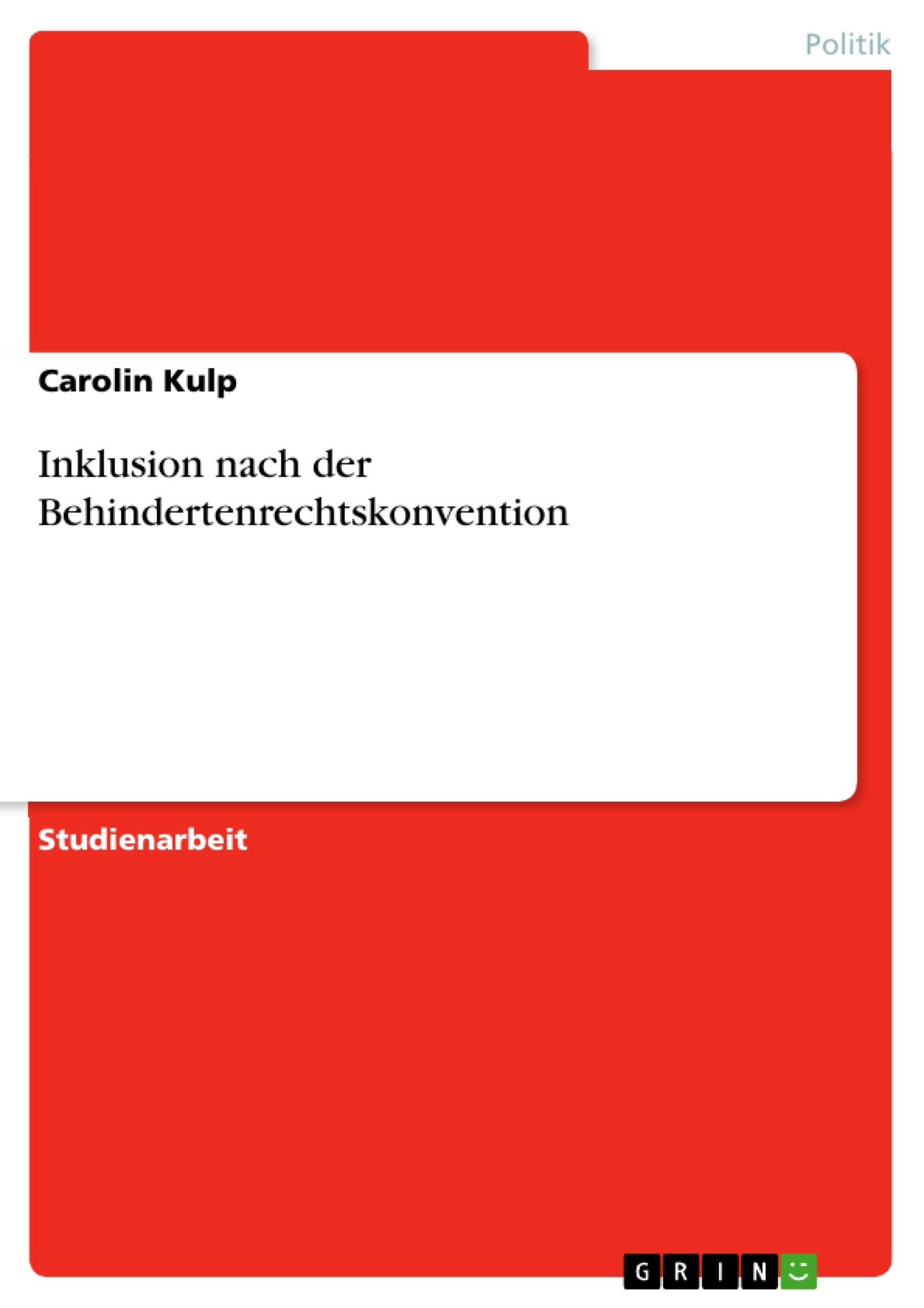Der Index für Inklusion gibt die Möglichkeit, eine inklusive Schulentwicklung zu fördern. Mit der dazugehörigen Materialsammlung (z.B. Fragebögen) kann er jeder einzelnen Schule bei den Schritten auf dem Weg hin zu einer „Schule für alle“ helfen, die eine Pädagogik der Vielfalt anstrebt. Er soll ein Hilfsmittel sein, um ein inklusives Leitbild der Schule zu entwickeln. Er benutzt den Begriff Inklusion, und meint damit die Erziehung und Bildung aller Kinder und Jugendlichen. Die drei Dimensionen des Index sind: inklusive Kulturen schaffen, inklusive Strukturen etablieren und inklusive Praktiken entwickeln.
Inhaltsverzeichnis
1. Die Behindertenrechtskonvention (BRK)
2. Theorieteil: Inklusion
3. Praxisteil: Stellungnahme einiger Politiker des Bayerischen Landtages zur Inklusion
4. Individuelle persönliche Position zur inklusiven Schule
5. Literatur- und Quellenverzeichnis