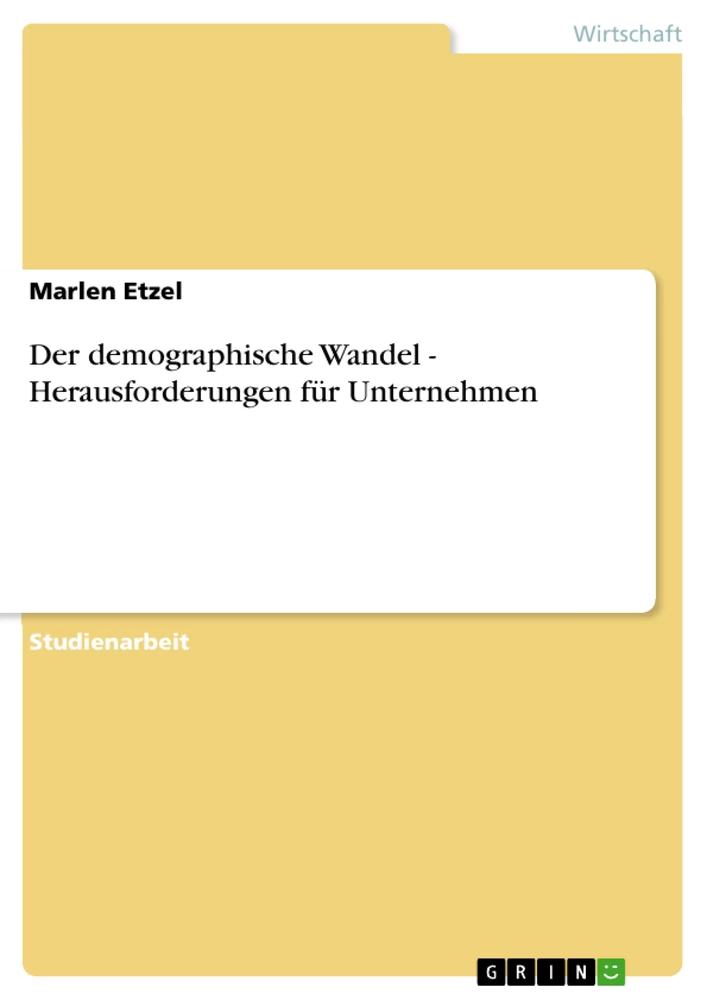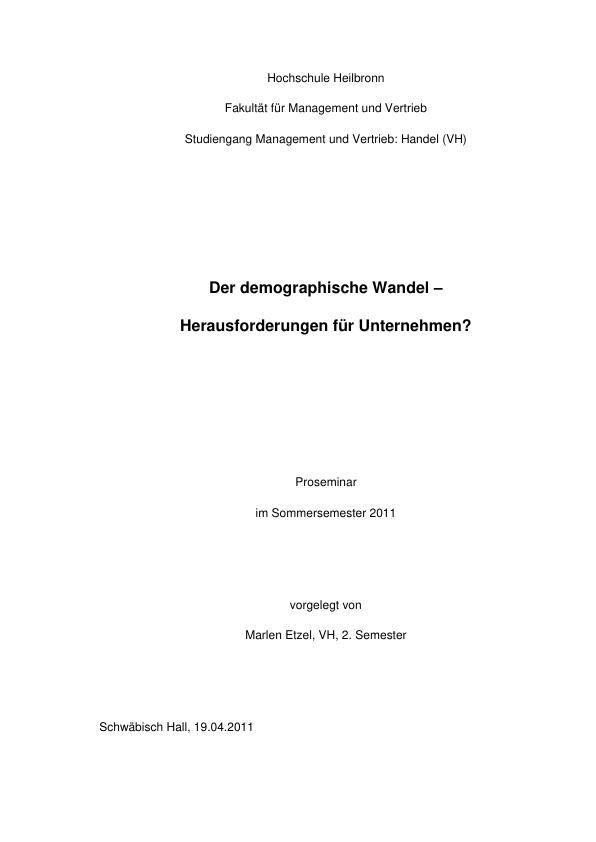Der demographische Wandel wird in den Medien oft als „die Mär der unproduktiven Alten“ dargestellt, Unternehmen fürchten die „Vergreisung der Belegschaft“ Deutschlands Bevölkerung wird zur „Prothesengesellschaft“. Tatsache ist, dass die Bevölkerung Deutschlands immer älter und weniger wird und daraus Herausforderungen für Politik und Wirtschaftsgeschehen. Ab 1. Mai 2011 werden die Türen für Osteuropäer aus Ländern, die 2004 der EU beigetreten sind, offen stehen. Polen, Tschechen, Slowaken, Slowenen, Ungarn und Balten können dann nach Deutschland kommen, ohne lange Wartezeiten, in denen früher geprüft wurde, ob dieser Arbeit nicht ein deutscher Erwerbstätige zur Verfügung stehe. Diese Maßnahme ist eine Reaktion auf den Mangel an jungen und vor allem qualifizierten Fachkräften, der uns in Deutschland bevorsteht. Leider kommt diese Maßnahme etwas zu spät. Die qualifizierten und hochqualifizierten Arbeitskräfte haben schon andere Länder nach der EU-Osterweiterung 2004 umworben und für sich gewonnen. Diese gesetzliche Maßnahme reiht sich ein zur debattierten „Frauenquote“ und Regelung der Rente ab 67. Auf politischer Ebene wird reagiert, jedoch scheint die Wirtschaft etwas zu zögern. So unterscheidet sich die Aussage von 2000: „Gegenwärtig wird das Problem des demographischen Wandels in den Betrieben unzureichend wahrgenommen.“ nicht sonderlich von der 2007: „Die Bedeutung demographischer Veränderungen für das eigene Unternehmen ist noch gar nicht erkannt worden“ . Kurzum müssen die Probleme hinsichtlich der älter und weniger werdenden Erwerbstätigen erkannt werden, und die Chancen die die älteren Konsumenten auf dem Absatzmarkt bieten genutzt werden, um positiv gegen den demographischen Wandel zu steuern.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Aktualität des Themas
1.2 Ziel und Aufbau der Arbeit
2 Der demographische Wandel
2.1 Begriffserklärung
2.2 Der demographische Wandel in Deutschland
3 Bedeutung des demographischen Wandels für Unternehmen
3.1 Personalmanagement
3.1.1 Anzahl der Erwerbstätigen
3.1.2 Alter der Erwerbstätigen
3.2 Neue Absatzmärkte
3.3 Fallbeispiel an der BMW Group
4 Fazit
Literaturverzeichnis