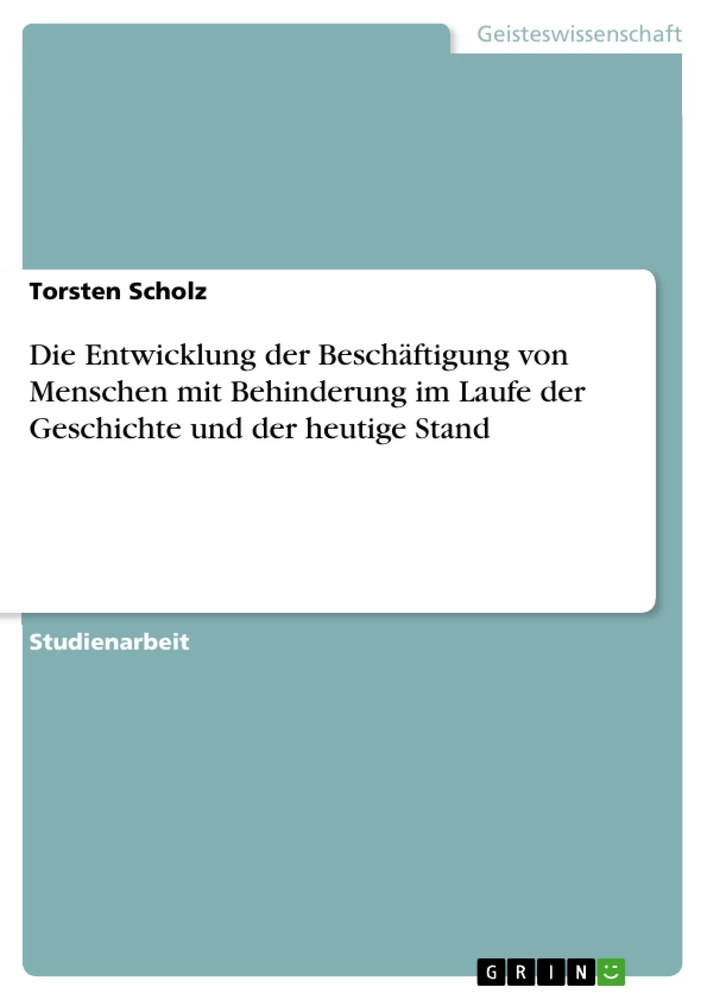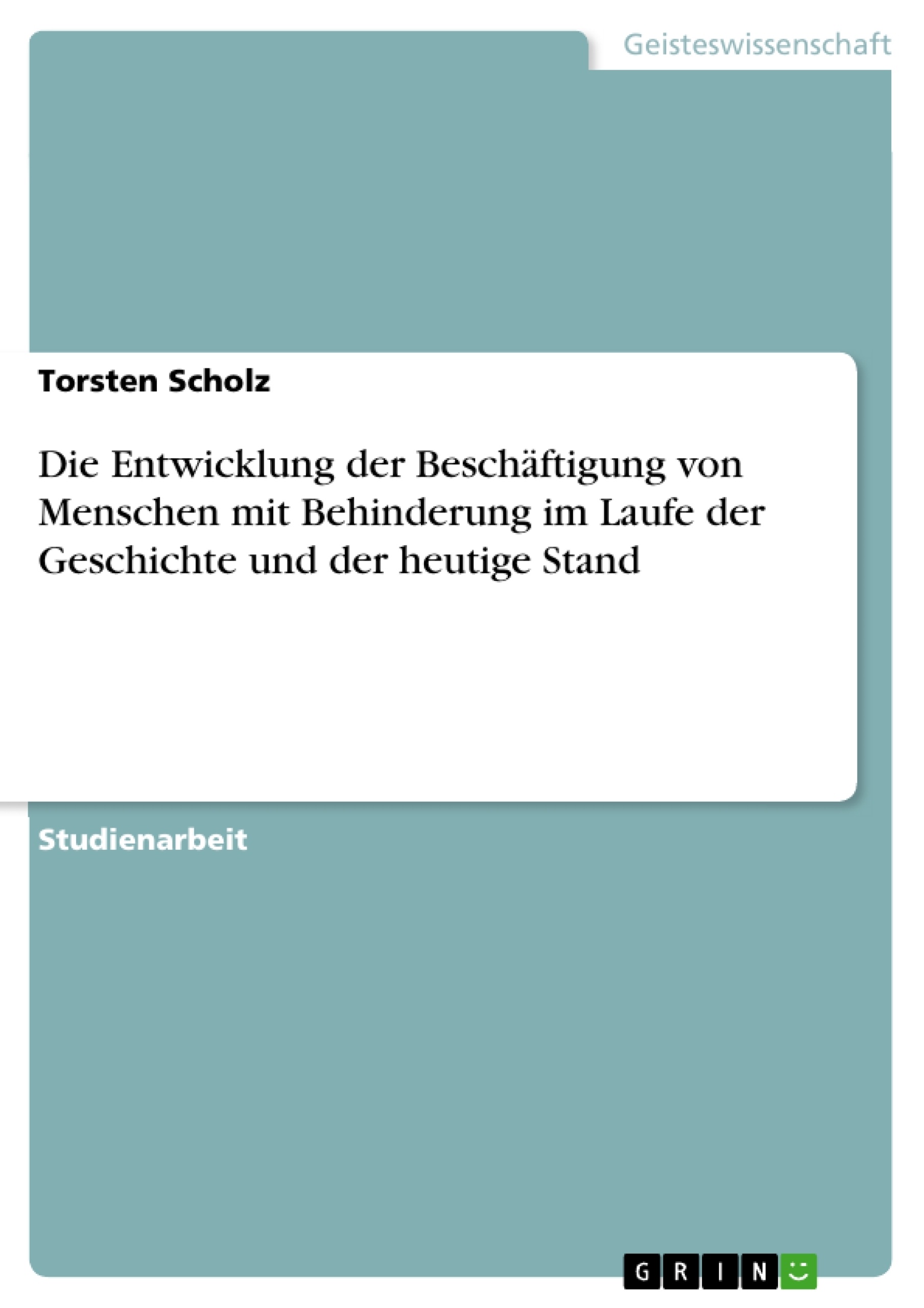Diese Hausarbeit entstand in Rahmen des Seminars „Teilhabe am Arbeitsleben bei Behinderung“ bei Herrn ... Thema des Seminars waren die Schwierigkeiten, mit denen Menschen mit geistiger oder körperlicher Behinderung bei der Teilhabe am Arbeitsleben konfrontiert werden. Dieses Seminar hat mich sehr interessiert, traf es doch genau mein Hauptinteresse während des Studiums der Sozialen Arbeit, da ich selbst meinen Zivildienst und mein BPS I-Praktikum im Rahmen des Studiums in einer Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) gemacht habe, einer Einrichtung, die gezielt dafür vorgesehen ist, Menschen mit Behinderung über die Teilhabe am Arbeitsmarkt Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen. Ich habe dabei also selbst in der Praxis gesehen, wie solche Einrichtungen funktionieren und wie sich in der Praxis trotz guter Ansätze immer noch gewaltige Schwierigkeiten ergeben, Menschen mit Behinderung Teilhabe zu ermöglichen. Dies ist mein Ausgangsinteresse und deshalb habe ich mich dazu entschlossen, mich in meiner Hausarbeit mit der geschichtlichen Entwicklung der Integration von Menschen insbesondere mit geistiger Behinderung in das Arbeitsleben unter besonderer Betrachtung der Werkstätten für behinderte Menschen auseinanderzusetzen – von den Anfängen der Beschäftigung behinderter Menschen in Arbeitsumfeldern über die Anfänge der Werkstätten bis hin zur heutigen Situation. Den Fokus möchte ich dabei so weit wie möglich auf die Klienten-Gruppe der Menschen mit geistiger Behinderung leben, da diese noch einmal auf komplett andere (und in der Regel größere) Schwierigkeiten bei der gesellschaftlichen und somit auch beruflichen Integration stoßen als Menschen mit körperlicher Behinderung und auch nach wie vor die Hauptzielgruppe der Werkstätten sind . Diese Hausarbeit soll deshalb der geschichtlichen Entwicklung des Umgangs mit geistig behinderten Menschen nachgehen und den aktuellen Stand der Entwicklung aufzeigen, unter der Fragestellung: Wie wurde mit Menschen mit Behinderung im Laufe der Geschichte umgegangen, wie wurden diese Menschen früher in die Arbeitswelt integriert und wie ist der Entwicklungsstand der Beschäftigung von Menschen mit geistiger Behinderung heute?
Es soll also in erster Linie ein geschichtlicher Abriss werden, der den allgemeinen Umgang mit Menschen mit Behinderung reflektiert und dabei auch so weit wie möglich die Versuche der Integration in die Berufswelt darzustellen versucht und darauf aufbauen den heutigen Stand zeigt.
[...]
Inhaltsverzeichnis:
Einleitung
1.Arbeit – ein Definitionsversuch
2.Die geschichtliche Entwicklung der gesellschaftlichen Teilhabe und Beschäftigung von Menschen mit Behinderung
2.1 Die Anfänge vom Altertum bis zum Mittelalter
2.2 Vom Mittelalter bis zum 19.Jahrhundert
2.3 Die Entwicklung im 19. und frühen 20. Jahrhundert bis zum Dritten Reich
2.4 Die Entwicklung zur Zeit des Dritten Reiches bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs
2.5 Die Entwicklung nach 1945 bis zu Beginn der 60er Jahre
3. Die Geschichte der Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM)
3.1 Die Gründung der ersten Werkstätten
3.2 Die heutige Situation der Werkstätten
3.2.1 Grundsätzliches
3.2.2 Aufbau
3.3 Kritik am Werkstatt-System
3.3.1 Prinzipielle Kritik
3.3.2 Finanzielle Kritik
3.3.3 Kritik im Zusammenhang mit der UN-Behindertenrechtskonvention
4 Fazit
5. Quellen