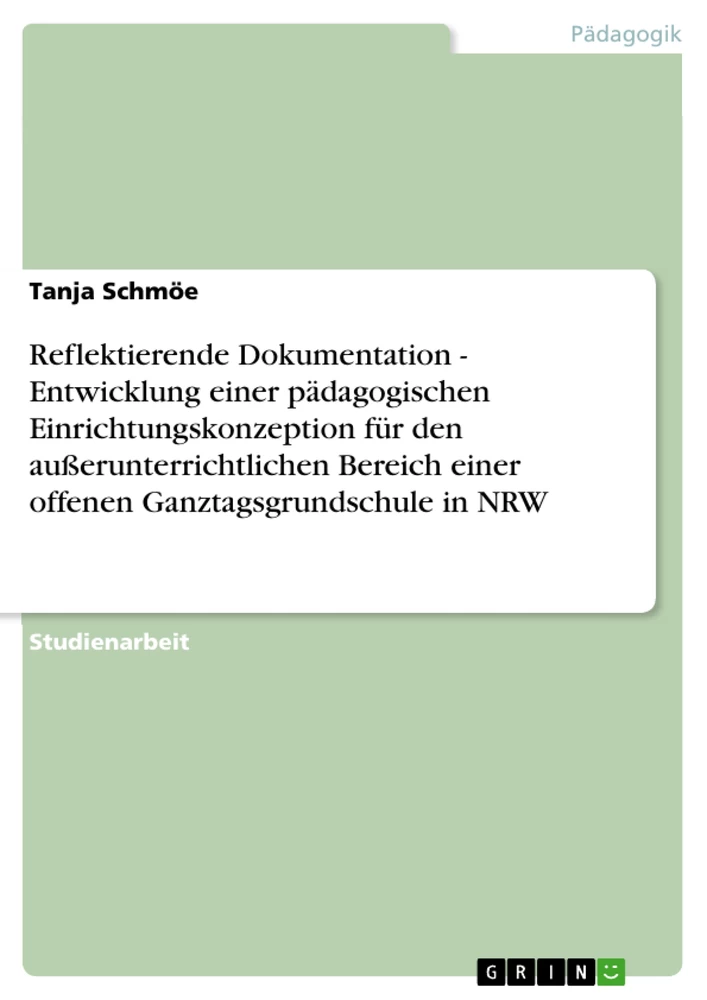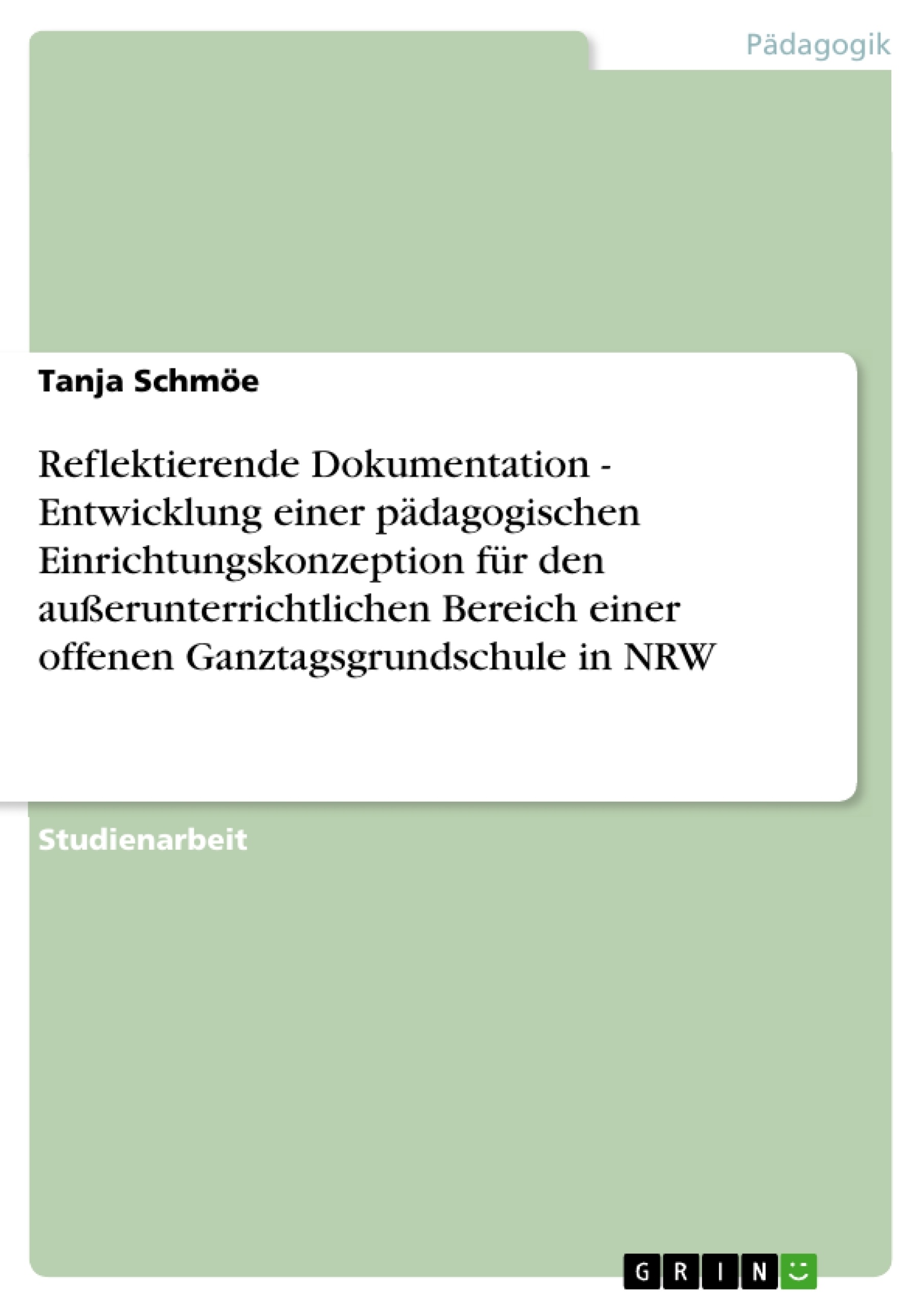Reflektierende Dokumentation zum Praktikumsmodul im Bachelor Bildungswissenschaft. Thema: Entwicklung einer pädagogischen Einrichtungskonzeption für den außerunterrichtlichen Bereich einer offenen Ganztagsgrundschule in NRW.
Inhaltsverzeichnis Seite
1. Einleitung
2.Praktikumsstelle
2.1.Organisatorische Rahmenbedingungen
2.2. Zielgruppenanalyse
3. Handlungsablauf
3.1. Projektinitiative
3.2. Projektskizze
3.3. Projektplan
3.4. Projektablauf
3.5. Abschluss
3.6. Fixpunkte
3.7. Metainteraktion
4. Projektmanagement
4.1. Theoretische Grundannahmen
4.2. Stellenwert innerhalb des Projektes
5. Qualitätssicherung
5.1 Theoretische Grundannahmen
5.2. Stellenwert innerhalb des Projektes
6. Evaluation
6.1. Theoretische Grundannahmen
6.2. Evaluierung im Projekt
7. Fazit und Ausblick
8. Literaturverzeichnis