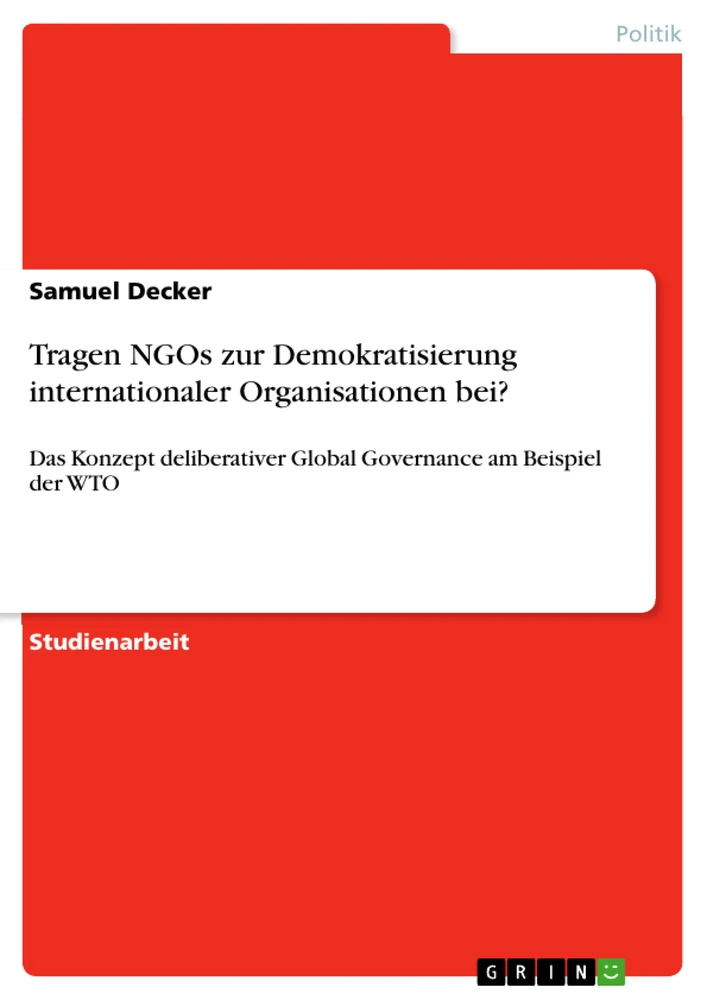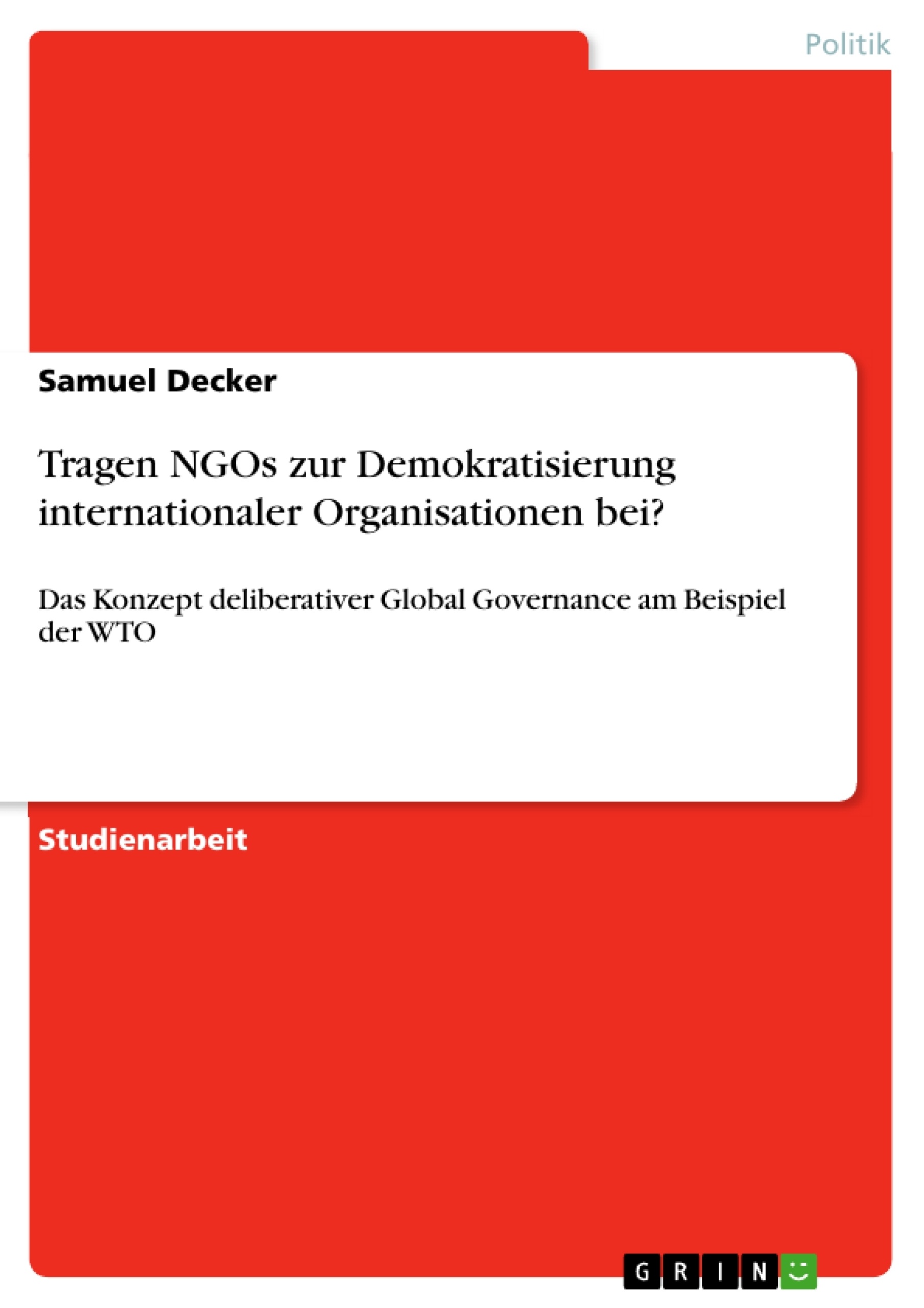Diese Arbeit beschäftigt sich mit der aktuellen Streitfrage innerhalb der Internationalen Beziehungen, ob und wie die transnationale Zivilgesellschaft zur Demokratisierung internationalen Regierens beitragen kann. Konzeptionelle Grundlage dabei ist das auf Jürgen Habermas zurückgehende deliberative Demokratiemodell, das sich von der Einflussnahme zivilgesellschaftlicher Akteure und der Institutionalisierung verständigungsorientierter Diskurse mehr demokratische Legitimität verspricht. Nanz und Steffek haben aus den Instruktionen der deliberativen Demokratietheorie die vier Analysekriterien Transparenz, Zugang, Responsivität und Inklusion abgeleitet, die in dieser Hausarbeit in Rezeption einer Fallstudie an die Willensbildungsprozesse der WTO angelegt werden. Dabei kommen strukturelle Defizite zum Vorschein, wie etwa unzureichende Partizipationschancen für NGOs und eklatante Machtasymmetrien zwischen zivilgesellschaftlichen und gouvernmentalen Akteuren. Die WTO kann ohne demokratische Reformen dem voraussetzungsreichen deliberativen Programm nicht gerecht werden, doch auch die NGOs weisen in demokratietheoretischer Hinsicht Mängel auf. Schlussfolgernd wird die Brauchbarkeit des deliberativen Steuerungskonzeptes an sich in Frage gestellt, da es auf Voraussetzungen gründet, die an der Realität der internationalen Politik vorbeigehen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Demokratie durch Deliberation
3. Das Beispiel der WTO
3.1. Einführung
3.2. Transparenz
3.3. Zugang
3.4. Responsivität
3.5. Inklusion
4. Fazit und Ausblick
5. Literaturverzeichnis