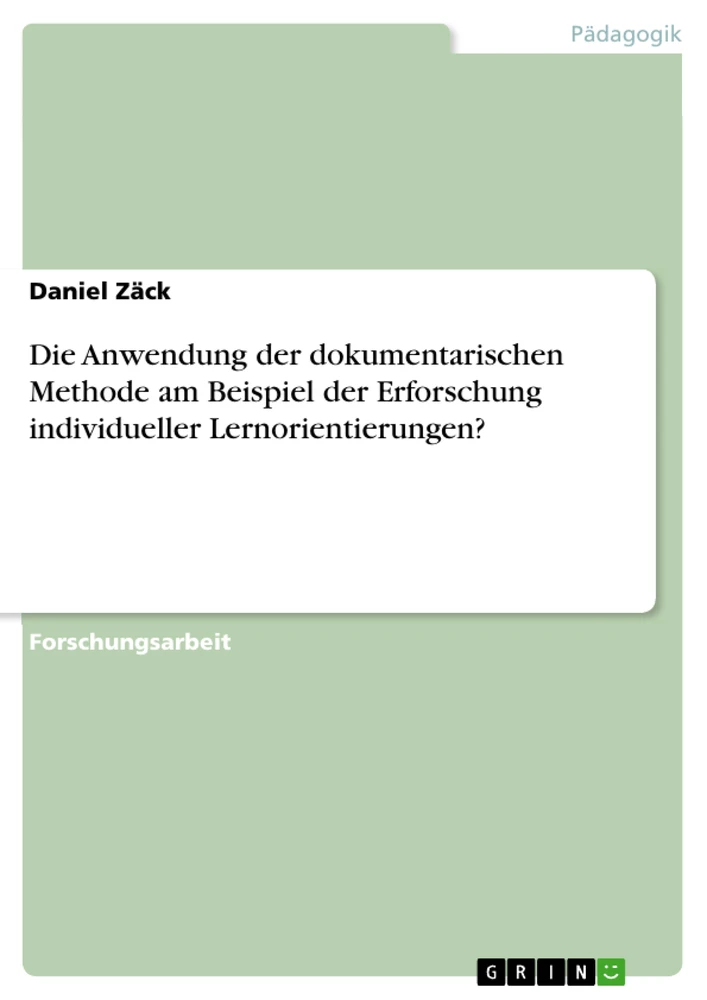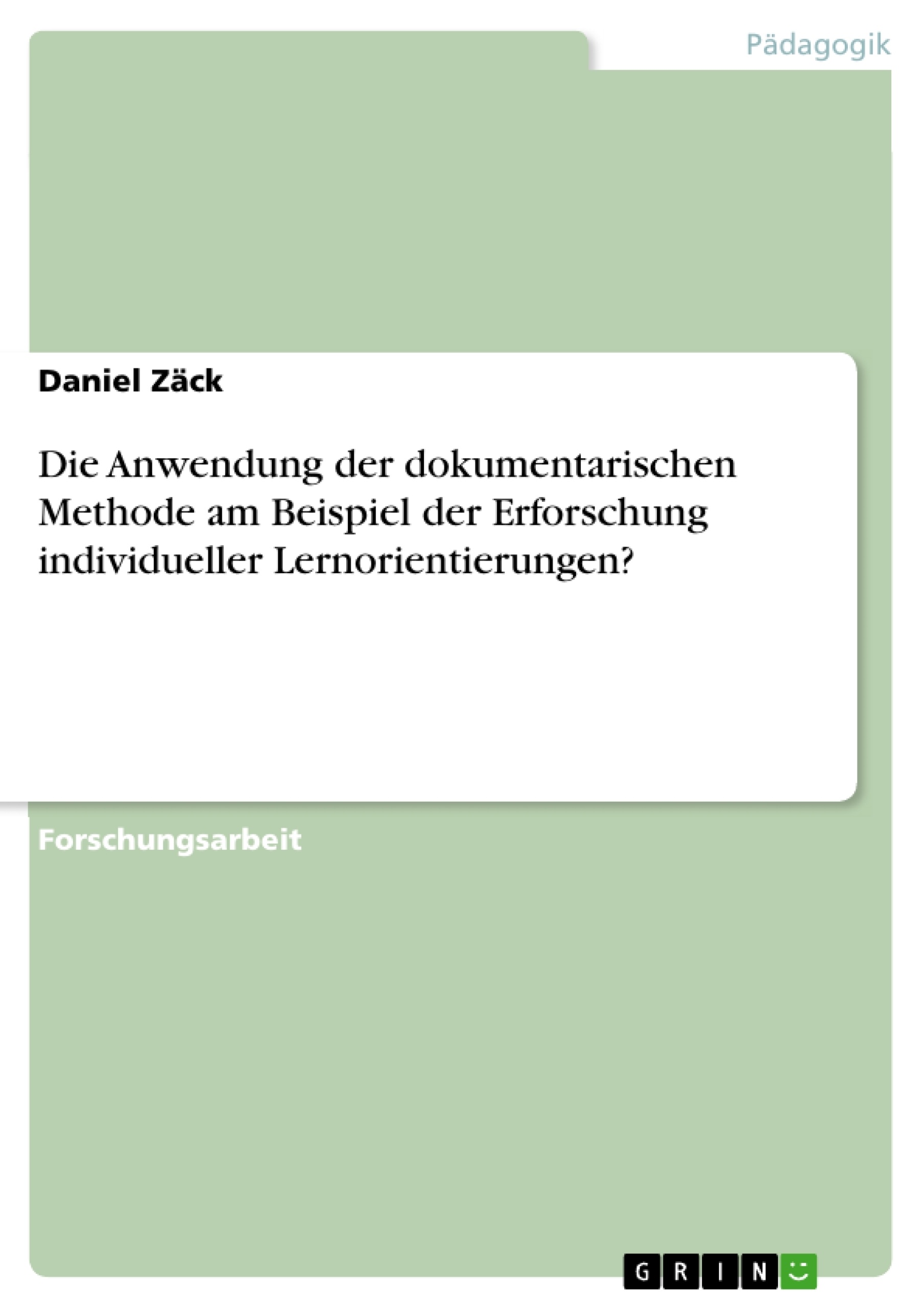In dieser Hausarbeit soll die dokumentarische Methode zur Auswertung und Interpretation eines narrativen Interviews Anwendung finden. Es soll der Frage nachgegangen werden, ob und wenn ja welcher Lernform bzw. welchem Lernmodus sich der Interviewte aufgrund seiner Handlungsorientierungen bedient. In einem theoretischen Teil werden das narrative Interview, die dokumentarische Methode und der Begrif der Lernorientierung abgehandelt. Danach wird die dokumentarische Methode an dem Transkript eines selbstdurchgeführten narrativen Interviews mit einem selbstständigen Autoteileverkäufer eingesetzt. Abschließend sollen die Ergebnisse dieser Arbeit zusammengefasst und einer Bewertung unterzogen werden. Dabei wird geprüft, ob die eingangs formulierte These bestätigt wurde.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Theoretischer Teil
2.1 Das narrative Interview
2.2 Die dokumentarische Methode der Interpretation
2.2.1 Formulierende Interpretation
2.2.2 Reflektierende Interpretation
2.2.3 Komparative Analyse und Typenbildung
2.3 Begriffseingrenzung Lernorientierung
3. Anwendung der Methode am Beispiel eines selbstständigen Autoteileverkäufers
3.1 Der Übergang von der Schule in den Beruf
3.2 Learning by doing und Mittel der Fehlervermeidung
3.4 Blick nach links und rechts bei der Suche nach Artikeln
3.5 Vergleich der Wissensaneignung zwischen Schule und Beruf
4. Schluss
Literaturverzeichnis