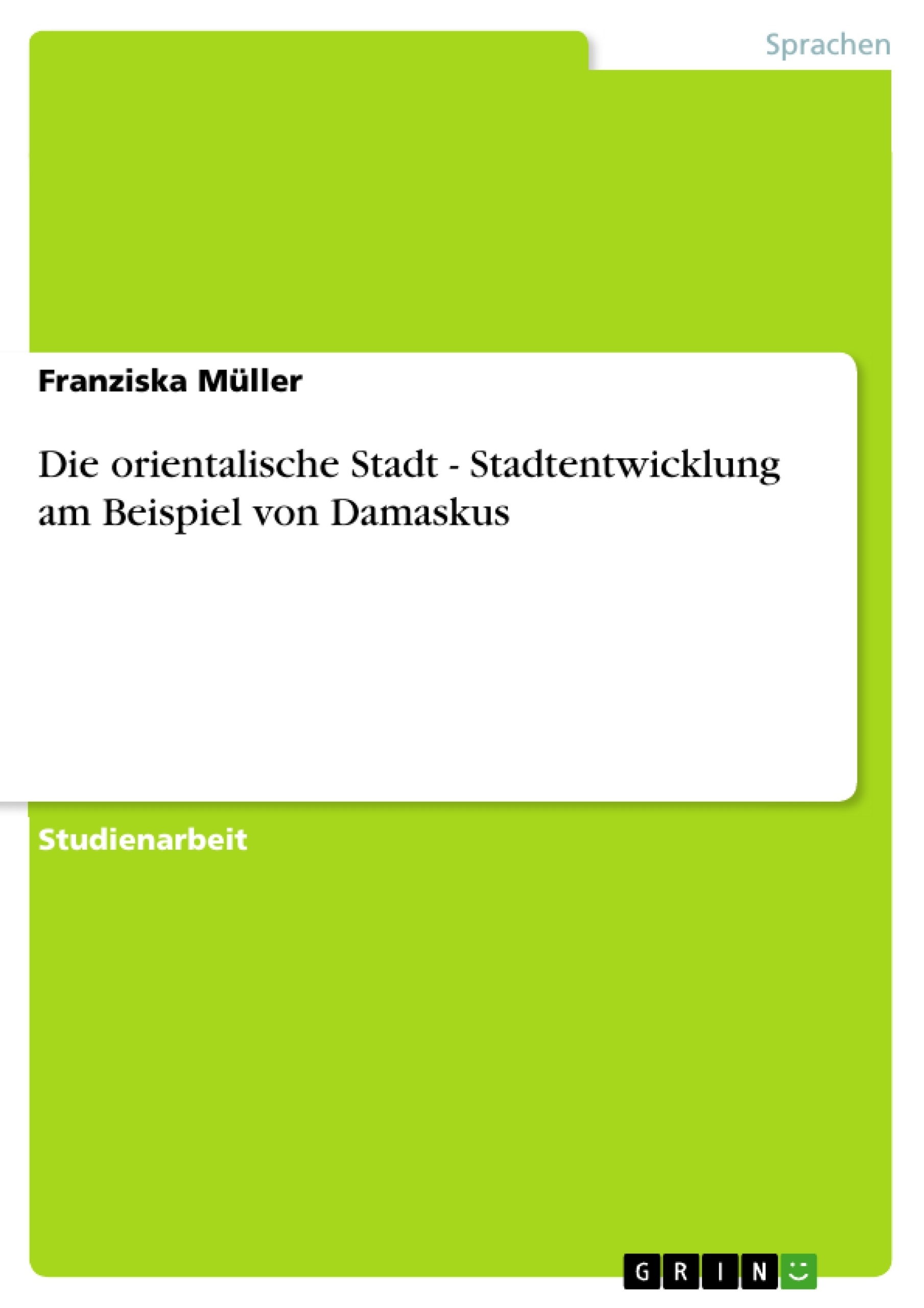Die syrische Hauptstadt Damaskus soll in der folgenden Ausarbeitung exemplarisch dazu dienen, den vorherrschenden Dualismus zwischen dem alten Funktionalgefüge einer orientalischen Stadt und dem westlich geprägten Modernisierungsanspruch einer islamischen Gesellschaft zu verdeutlichen. Des weiteren soll geklärt werden, ob das von Klaus Dettmann entworfene „Idealschema des Funktionalgefüges der islamisch-orientalischen Stadt“1eine verwertbare Grundlage darstellt, oder ob der Wandel der Zeit, das Vordringen westlicher Einflüsse und die bedeutende Tatsache der wechselnden religiösen Einflüsse vor der „endgültigen Islamisierung“ dafür gesorgt haben, dass sich der ursprüngliche Stadtkern mit all seinen Funktionsbereichen verschoben, gar verändert, oder niemals jenen Schemata entsprochen hat.. Einleitend zu dieser Thematik soll zunächst ein historischer Abriss der Stadtentwicklung von Damaskus erfolgen. Anknüpfend an diese Darlegung wird eine Veranschaulichung des Modells von K. Dettmann erfolgen und diese auf ihre Kompatibilität mit dem heutigen Damaskus überprüft werden. Abschließend folgt ein Fazit bzw. ein Rückbezug auf das vorangegangene.
Die orientalische Stadt - Stadtentwicklung am Beispiel von Damaskus
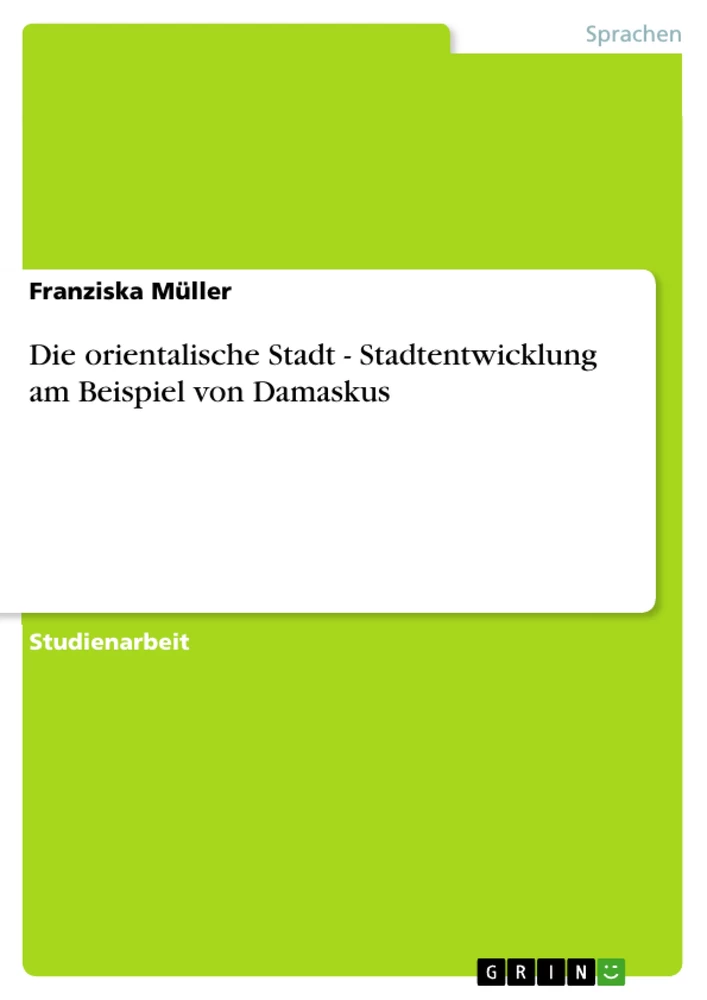
Hausarbeit , 2010 , 7 Seiten
Autor:in: Franziska Müller (Autor:in)
Orientalistik / Sinologie - Islamwissenschaft
Leseprobe & Details Blick ins Buch