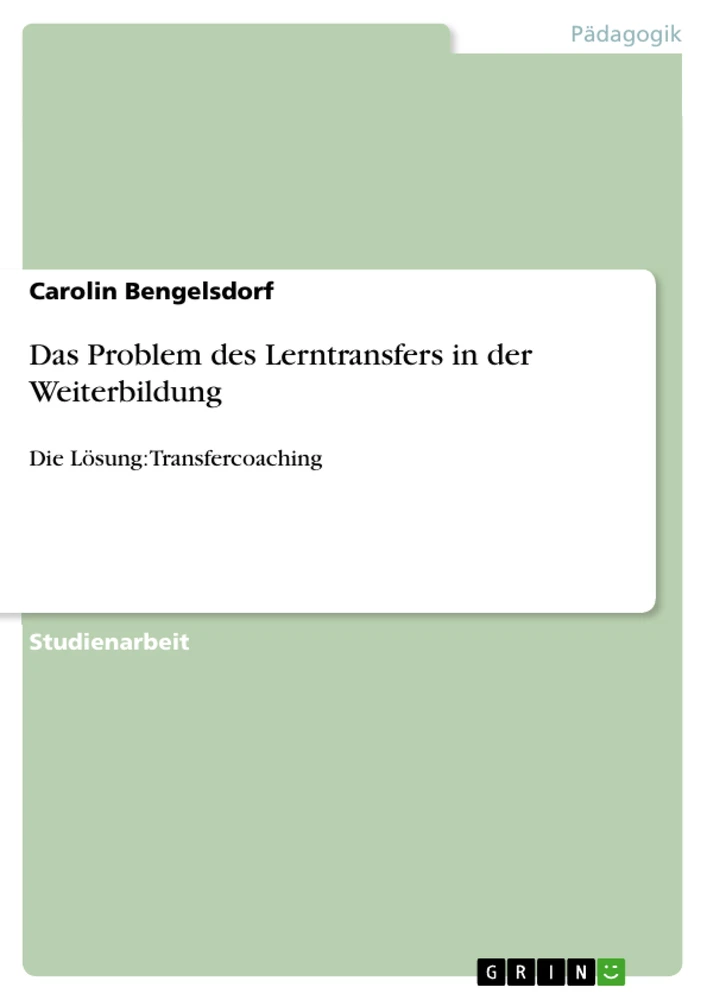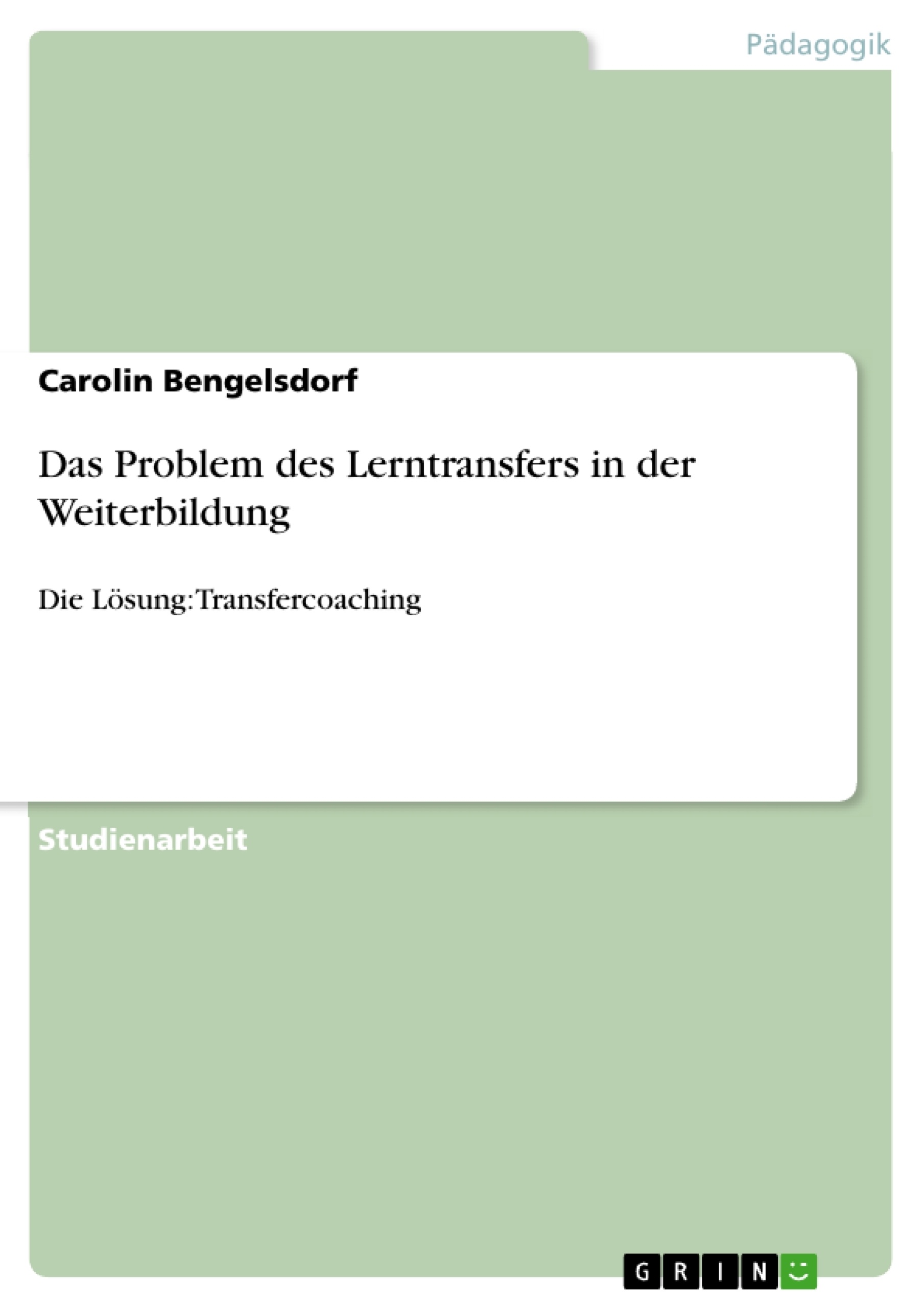Jedes Jahr investieren deutsche Unternehmen Milliarden Euros in Weiterbildungsprogramme. Nach Kellner (2006) verlassen sich die Mehrheit der Personalentwickler und Trainer darauf, dass sich der Erfolg nach Seminaren und Trainings schon automatisch einstellen werde (vgl. Kellner 2006, S. 14). Doch in der Praxis findet sich ein anderes Bild wieder. Nur rund zehn bis 20 Prozent von dem, was in Trainings faktisch gelernt wird, wird auch nachhaltig am Arbeitsplatz angewandt (vgl. Geißler 2010a, S. 24; vgl. auch Kauffeld 2010, S. 110). Seit langem beklagt die Trainingsforschung, dass Gelerntes vielfach gar nicht oder nur unzureichend ein- bzw. umgesetzt wird, wenn die Teilnehmer einer Weiterbildungsmaßnahme an den täglichen Arbeitsplatz zurückkehren (vgl. Solga 2011, S. 339, vgl. auch Seufert 2008, S. 101). Somit ist eines der größten Herausforderungen das Transferproblem, „d.h. das Problem, dass das, was in einer Weiterbildungsmaßnahme gelernt worden ist, anschließend viel zu wenig in der Praxis angewendet wird“ (Geißler 2011, S. 123). Die Ursache dafür liegt vorwiegend in der unzureichenden Unterstützung in der Transferphase, die als eine eigenständige Lernphase verstanden werden muss. Für eine erfolgreiche Implementierung und Umsetzung einer Weiterbildungsmaßnahme und dessen Lerntransfer ist somit eine nachhaltige personelle Unterstützung von besonderer Bedeutung. Nach Geißler (2010) lässt sich das Problem des Transfers durch Coaching als Prozessbegleitung lösen. Dabei bieten sich zwei Varianten an. Zum einen kann die Unterstützung durch ein traditionelles face-to-face-Coaching erfolgen. Zum anderen wird das sogenannte ‚Virtuelle Transfercoaching‘ (VTC) als Lösung für das Problem gesehen (vgl. Geißler 2011, S. 123). Beide Varianten dienen der individuellen Nachbereitung der Teilnehmer von Weiterbildungsmaßnahmen. Dabei erfolgt eine Integration von Seminar und Coaching, um die Nachhaltigkeit von Maßnahmen zu erhöhen. Aus diesem Grund beschäftige ich mich mit der Frage, inwieweit das Konzept des sogenannten Transfercoaching zur Lösung des Transferproblems beitragen kann.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Ein Zugang zur Thematik des Transferproblems in der Weiterbildung
2.1. Definition von Lemtransfer
2.2. Das Problem des Lerntransfers
3. Transfercoaching
3.1. Virtuelles Transfercoaching (VTC)
3.2. Transfercoaching der SICK AG
3.3. Transfercoaching: Ein Fazit
4. Schlussbetrachtung
Anhang
Literaturverzeichnis