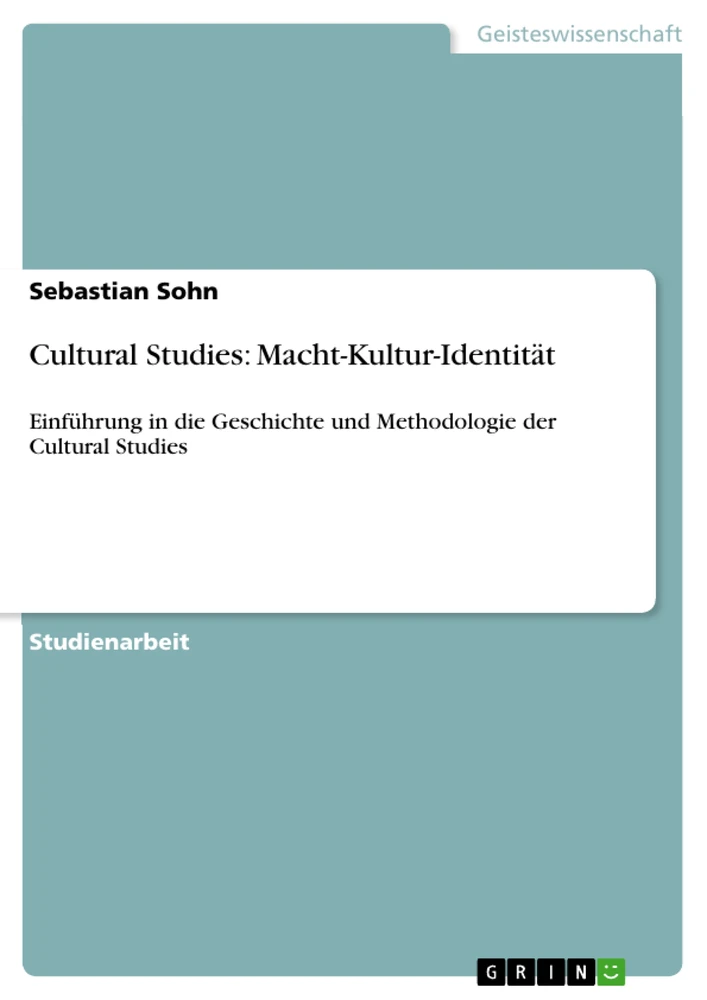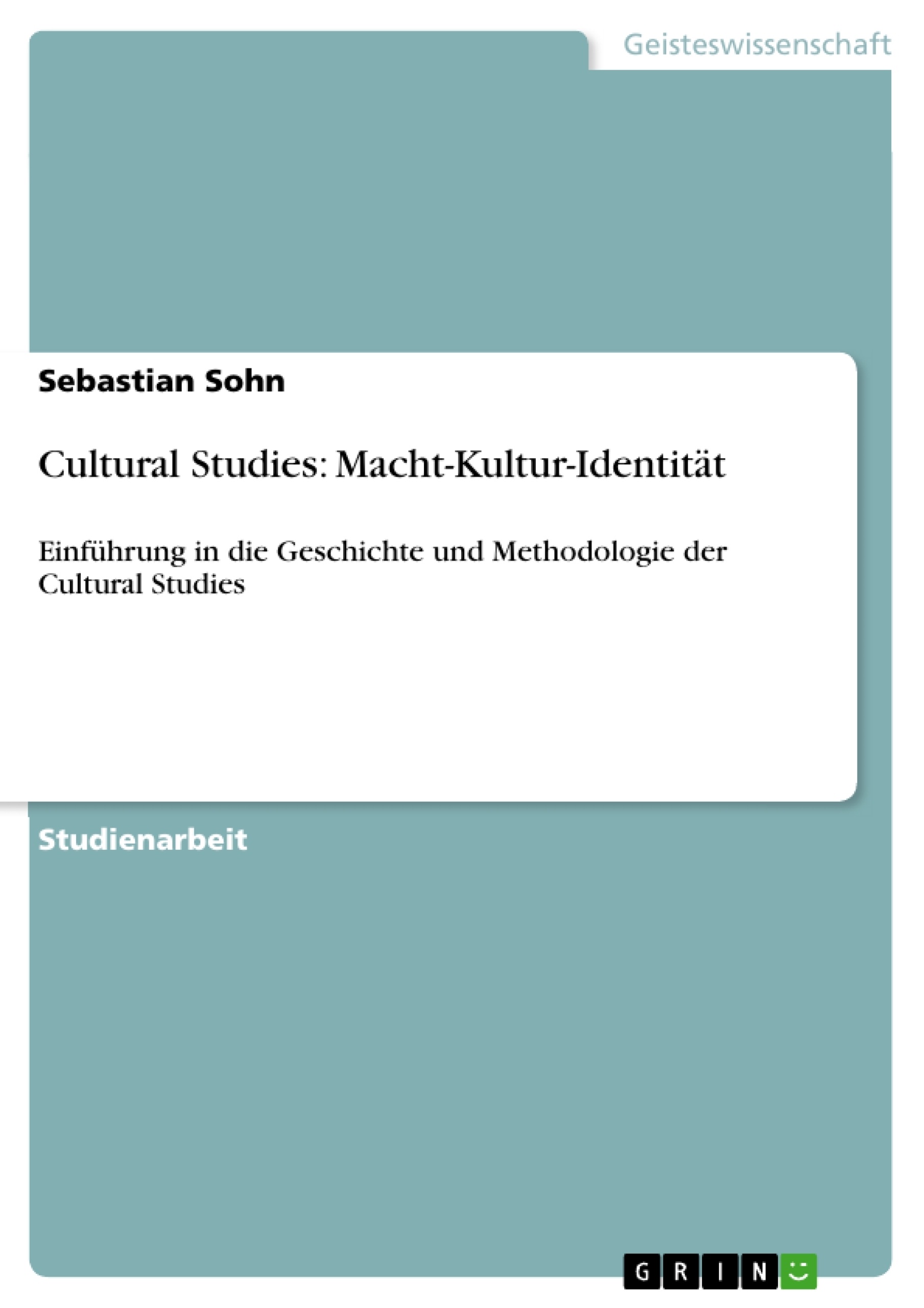Ziel dieser Proseminararbeit ist es, einen Überblick über die Entstehung und die Entwicklung der Cultural Studies zu liefern. Dabei sollen sowohl die historischen Hintergründe als auch die Methoden und Grundkategorien dieser Wissenschaftstradition vorgestellt werden.
Die gesellschaftspolitischen Veränderungen im England des ausgehenden 19. und im 20. Jahrhundert und die mit selbigen Entwicklung einhergehende Veränderung der gesellschaftlichen Auffassung des „Kultur“-Begriffes an sich sollen durch eine eingehende Analyse von Primär- und Sekundärliteratur der Cultural Studies vorgestellt und diskursanalytisch betrachtet werden. In reiner Theoriearbeit sollen auf der einen Seite die Autoren und Pioniere der Cultural Studies vorgestellt werden und die Grundzüge der politischen Tradition dieser Wissenschaftstheorie nachgezeichnet werden. Auf der anderen Seite sollen die Nachbetrachtungen der Methoden und Paradigmen, die für die weitgefächerten Anwendungsgebiete der Cultural Studies typisch sind im zweiten Teil der Arbeit vorgestellt werden.
Da die Cultural Studies als politische Wissenschaft verstanden werden muss, können die historischen und gesellschaftspolitischen Veränderungen nicht von der Analyse der Methoden getrennt werden, vielmehr müssen die Cultural Studies auch in ihrer Nachbetrachtung immer in diesen Kontext eingebunden werden, um ihrem selbstverordneten politischen Auftrag und ihrer Selbstreflexivität gerecht werden zu können.
Diese Arbeit beschäftigt sich ausschließlich mit der Auseinandersetzung der Cultural Studies mit sich selbst und in der Retrospektive durch Autoren, welche die allgemeine Grundzüge dieser Theorietradition beschreiben wollen sowie den großen politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, praktische Anwendungsbeispiele für die Arbeit der Cultural Studies im wissenschaftlichen Feld sind nicht berücksichtigt worden.
INHALT
1.Einleitung
2. Die Entstehung der Cultural Studies
2.1 Die (Vor)-Geschichte der Cultural Studies bis 1945
2.2 Die Konsolidierungsphase 1945-1964
2.3. Das Centre for Contemporary Cultural Studies (ab 1964)
3. Die zentralen Begriffe der Cultural Studies: Macht-Kultur-Identität
4. Die Methode(n) der Cultural Studies
4.1 Die Grundparadigmen der Cultural Studies
5.Fazit
6.Bibliographie