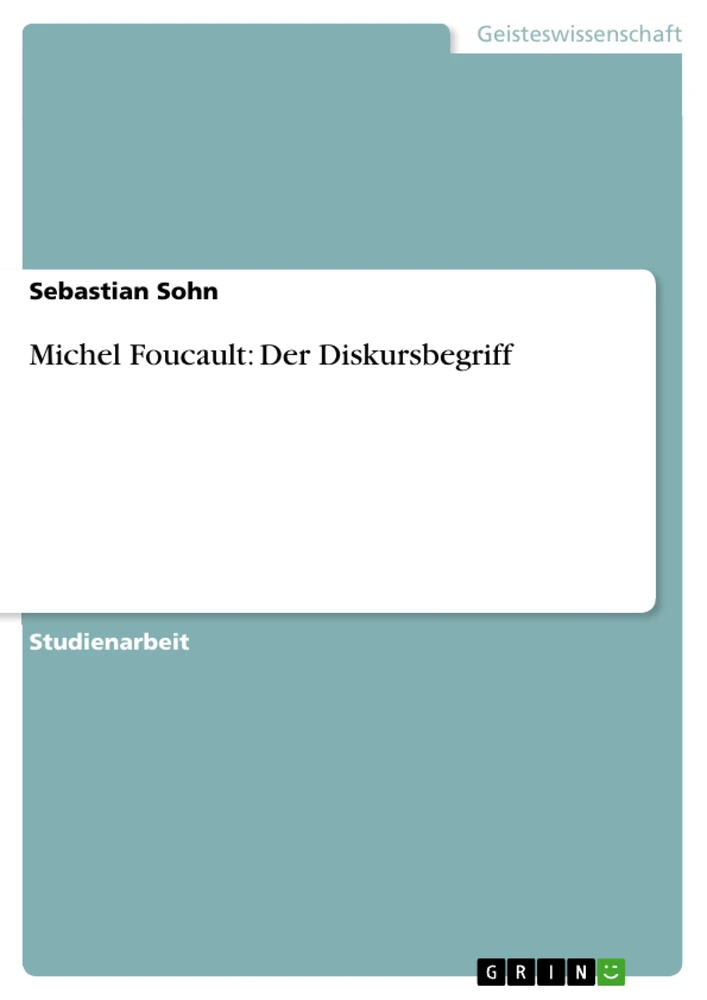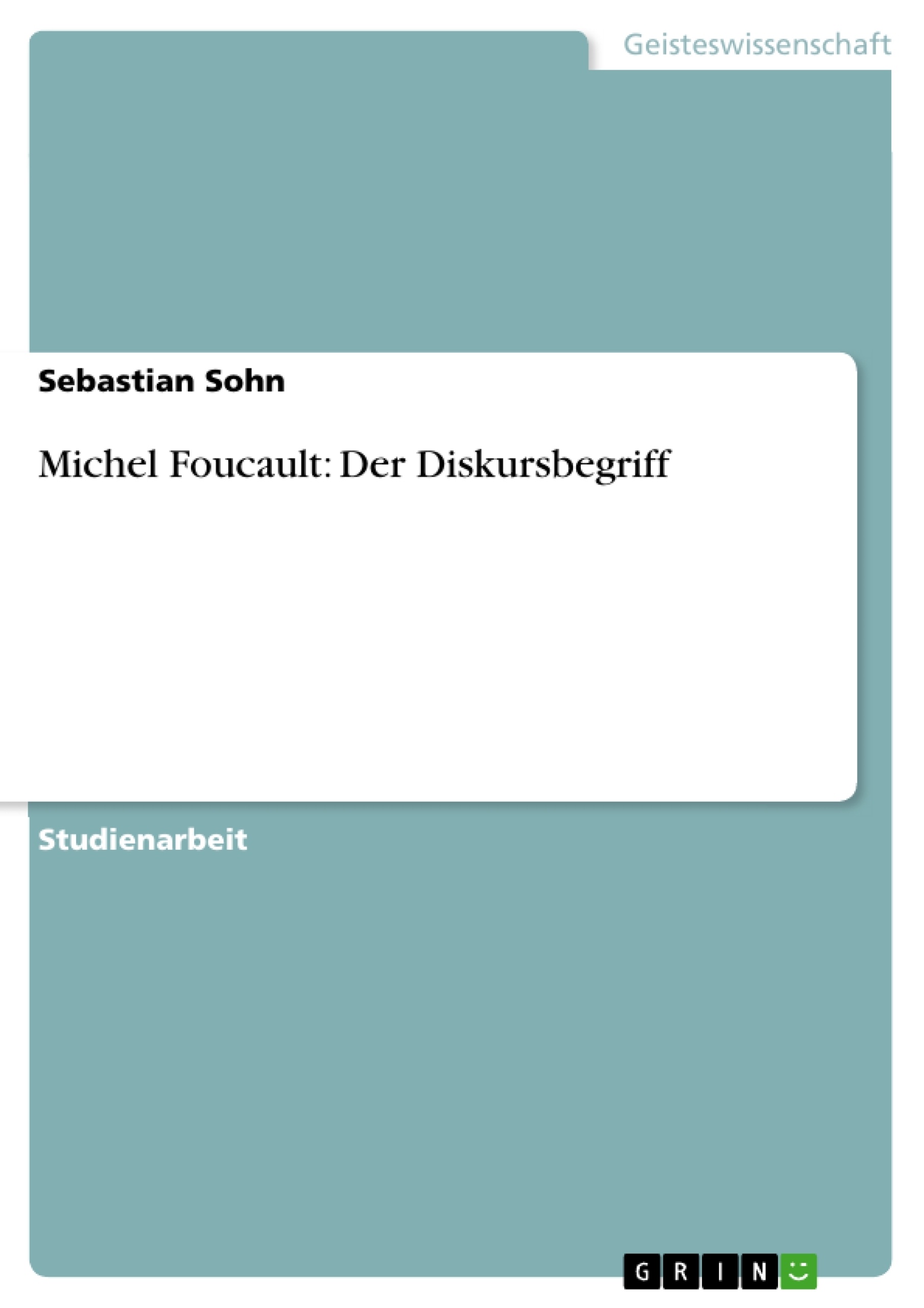Ziel dieser Arbeit ist es, die Theorie der Ordnung des Diskurses von Michel Foucault zu beschreiben. Foucault entwickelt eine eigene Definition, was unter einem Diskurs zu verstehen ist, wie er im Inneren funktioniert und wie er nach Außen wirkt. Foucault schreibt dem Diskurs an sich eine zentrale Bedeutung in der Frage zu, wie Wissen entsteht, wie es sich verteilt und wie es in konkreten Zusammenhängen seine Anwendung findet.
Als zentrales Element der Theorie Foucaults soll zunächst der Begriff des Diskurses definiert werden, wie Foucault ihn verwendet, unter anderem in seiner „Archäologie des Wissens“.
Anschliessend sollen am Beispiel der Strafjustiz und deren Veränderungen innerhalb der letzten 2 Jahrhunderte, die theoretischen Überlegungen über den Diskurs in einen konkreten Zusammenhang gestellt werden.
Von zentraler Bedeutung sind in diesem Teil der Arbeit die Machtverhältnisse eines Diskurses, die sich in ihrer architektonischen Manifestierung, dem Panopticon und der Theorie des Panoptimus, in „Überwachen und Strafen“ wiederfinden lassen. Dieser weitere Schritt ist notwendig, um die theoretischen Formulierungen, die Foucault über die Ordnung eines Diskurses trifft, an konkreten Beispielen deutlicher zu machen.
Zusammenfassend sollen die folgenden beiden Leitfragen beantwortet werden:
1. Was zeichnet einen Diskurs im Sinne Michel Foucaults aus?
2. Wie werden die Machtstrukturen der Diskurse in konkreten gesellschaftlichen Zusammenhängen sichtbar?
Die vorliegende Arbeit besteht aus reiner Theorieanalyse anhand der Primärliteratur Foucaults, sowie der Beschreibung der vom Autor verwendeten Beispiele (Strafjustiz, Panopticon), sowie eine Ergänzung durch ein soziologisches Wörterbuch. Diese, auf die Primärliteratur Foucaults fokussierte Literaturauswahl ist bewusst getroffen worden, um die Überlegungen Foucaults möglichst unverändert wiedergeben zu können.
In diesem Sinne wurde bewusst auf Vereinfachungen, Tabellen oder Grafiken verzichtet, um den Weg der Theorieentwicklung deutlich zum Ausdruck zu bringen.
Aus dieser Theorieanalyse ergibt sich noch keine stringente, diskursanalytische Methodenbeschreibung, so wie sie z.B. in der Sozialforschung zur Anwendung kommt; es wird vielmehr der Weg beschrieben, auf dem Michel Foucault seine Überlegungen zum Diskurs und dessen Macht über menschliches Handeln entwickelt hat.
INHALTSVERZEICHNIS
1. Einleitung
2. Grundbegriffe: Wissen, Diskurs, Wahrheit und Macht
2.1. Zusammenfassung
3. Von der Marter zur Bestrafung: Die Ökonomie der Züchtigung
3.1. Die peinliche Strafe: Die Abschaffung der Marter
3.2. Das Zeitalter der Strafnüchternheit
3.3. Zusammenfassung
4. Macht und Disziplin
4.1. Das Panopticon/ Der Panoptismus
5. Fazit und Ausblick
6. Bibliographie: