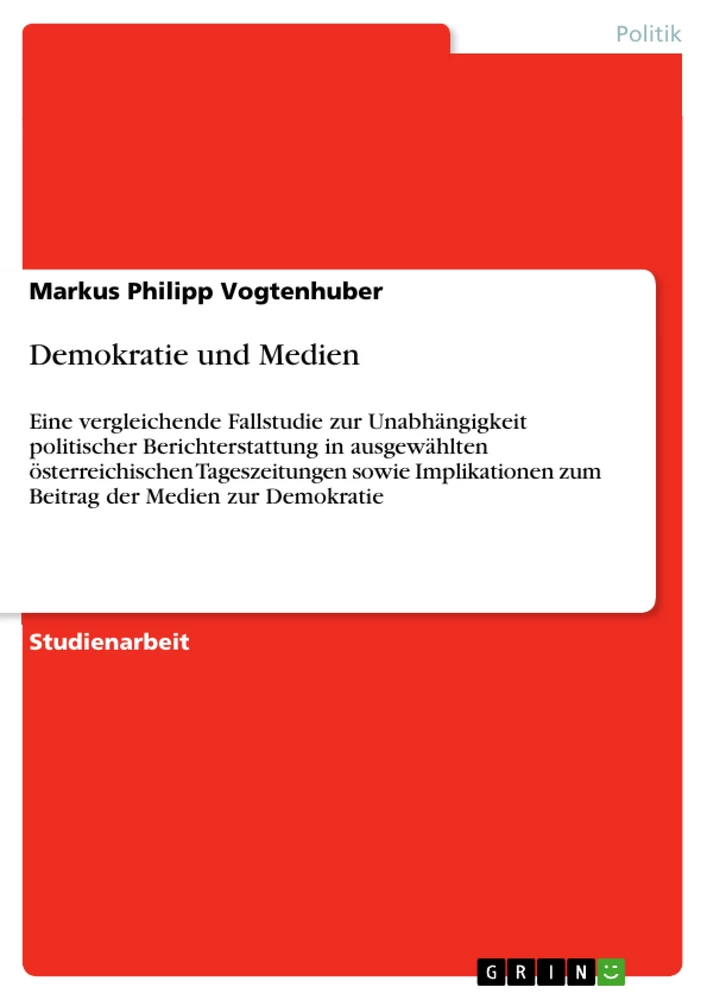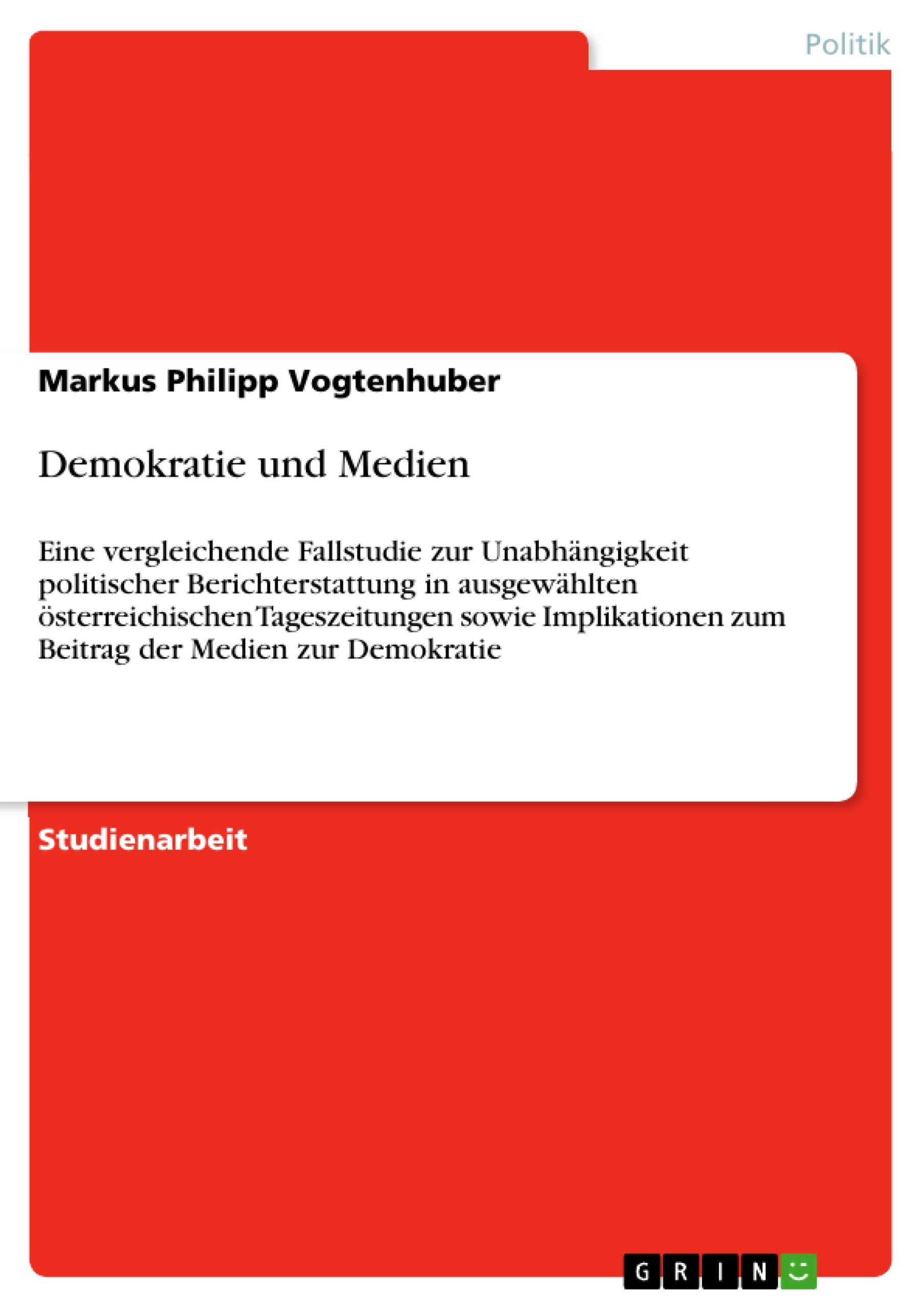Trotz einer von zahlreichen Autoren bestätigten bedeutenden Rolle von Medien für die Demokratie, sowie der großen Bedeutung kommunikativer Tätigkeiten zur Wahrnehmung von Souveränität in einer Massengesellschaft, wird den Medien als demokratische Institution in der politikwissenschaftlichen Demokratietheorie nur eine untergeordnete Rolle zugewiesen. So beschäftigen sich nur ein Bruchteil der Beiträge in politikwissenschaftlichen Fachzeitschriften mit dem Thema Medien und Kommunikation. Aufgrund dieses bescheidenen Interesses der Demokratietheorie an diesen Kommunikationsmitteln, möchten wir mit unserer Arbeit ein Stück weit zur Analyse der Rolle der Medien für die nationale Demokratie bzw. die Demokratisierung transnationaler politischer Systeme beitragen. Im Zentrum unserer Analyse liegt dabei das Augenmerk auf der Gefahr des potentiellen Manipulationscharakters durch die Medien, welcher ihnen aufgrund ihrer bedeutenden Stellung als „Gatekeeper“ und „Agenda-Setter“ zukommt. Dieser „Politikdependenzthese“, dass Medien als unabhängige Akteure agieren und die Politik von ihnen abhängig ist, werden wir die „Medienfunktionalisierungsthese“ von Manfred Prisching (2011) gegenüberstellen, welche besagt, dass Politiker die Medien instrumentalisieren können, um ihre Botschaften zu verbreiten, und Medien somit „abhängig“ seien.
Da jedoch weder manipulierende noch instrumentalisierte Medien als förderlich für ein demokratisches politisches System gesehen werden können, werden wir im Weiteren auf idealtypische Anforderungen an Medien zur Förderung von Demokratie eingehen und diese im Anschluss durch eine empirische Medienanalyse ausgewählter Tageszeitungen überprüfen.
Inhaltverzeichnis
1. Einleitung
Beitrag der Medien zur Demokratie
Beitrag der Medien zur Demokratisierung der Europäischen Union
Gefahr des potentiellen Manipulationscharakters der Medien
Anforderungen an die Medien zur Förderung der Demokratie
Forschungsleitende Fragestellung
Hypothese
Abgrenzung der Forschung
Forschungsdesign
Fallauswahl
Grundgesamtheit/ Stichprobe
2. Operationalisierungen
Politisches Machtverhältnis
Unabhängigkeit der Berichterstattung
Gewichtungsvariablen
Wie wurde gezählt?
Datenmatrix
Erwartete Ergebnisse
3. Hauptteil
Analyse Artikelhäufigkeiten – OÖ/OÖN
Analyse der Machteinheit als Einflussgröße – OÖ/OÖN
Analyse Artikelhäufigkeiten – Sbg./SN
Analyse der Machteinheit als Einflussgröße – Sbg./SN
Resümee
4. Beantwortung der Fragestellung und Hypothese
Hypothese
5. Anhang/ Abkürzungsverzeichnis
6. Anhang/ Literatur- und Quellenverzeichnis
Dokumente/ Zeitungen
Internetquellen
Literaturliste