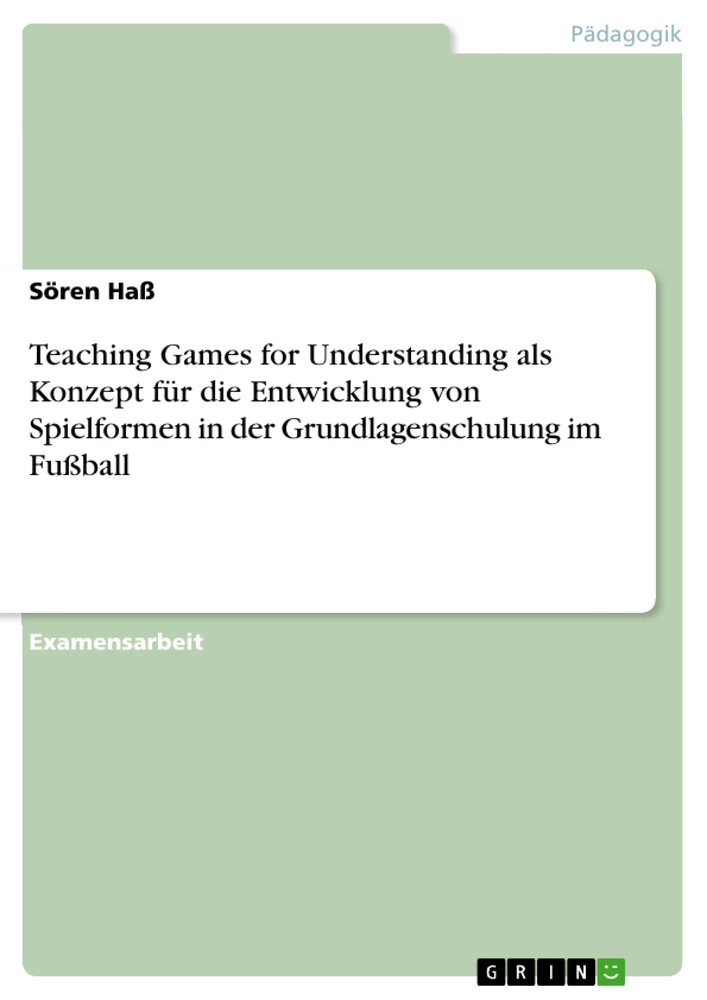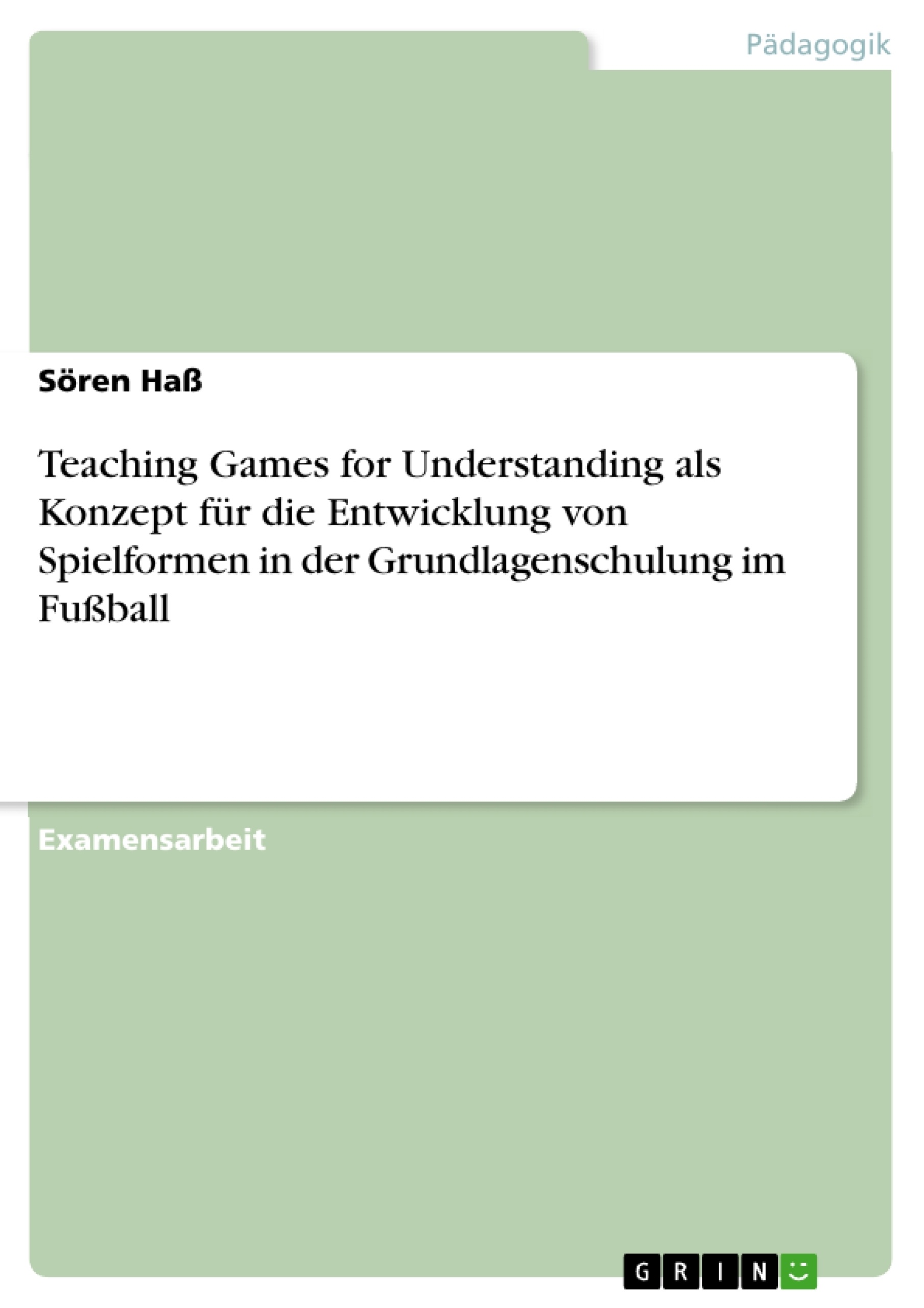Im Rahmen der vorliegenden Examensarbeit gehe ich auf die Entwicklung von Spielformen für das Sportspiel Fußball auf der Basis des Konzeptes „Teaching Games for Understanding“1 ein. Im Laufe meines Studiums habe ich mich mit diesem Sportspiel intensiver befasst. Als lizenzierter DFB-Stützpunkttrainer besteht mein Aufgabengebiet auch darin, Vereinstrainer in ihrer Arbeit mit den Nachwuchsspielern und mit ihrer damit verbundenen Ausbildung und Förderung im Training zu beobachten. Dabei stellte ich vermehrt fest, dass viele Jugendtrainer in ihrem Training einen relativ großen Anteil an isolierten Übungen und nicht spielnahen Spielformen mit ihren Mannschaften durchführten. Diese Beobachtung bestätigt sich auch in meiner Tätigkeit in der Trainerausbildung des Niedersächsischen Fußballverbandes. Die angehenden Trainer weisen häufig eine Tendenz auf, auch im Grundlagen- und Aufbautraining (Bambinis bis D-Junioren) einen relativ geringen Anteil spielnaher Spielformen im Training einzusetzen und sich mit den oftmals weniger komplexen Übungsformen gerade in Sachen Fehlererkennung und deren Korrektur „wohler zu fühlen“ (vgl. Cassia, 2010). Dazu stellt Cassia (2010, S. 4) fest:
„Statt die Aufmerksamkeit der Spieler auf das „Was“, Wann“ und „Warum“ der einzelnen
Vorgänge zu lenken, konzentriert man sich lediglich auf das „Wie“ der Ausführung. Tatsächlich wenden viele Trainer noch immer Unterrichtsformen an, die nur den korrekten Vollzug der Bewegungsabläufe zum Ziel haben, anstatt die Wahrnehmungs- und Entscheidungsfähigkeit ihrer Spieler zu fördern.“
In der vorliegenden Arbeit beschäftige ich mich deswegen mit der Entwicklung eines Trainingsprogrammes auf Basis von Spielformen gemäß des TGfU-Konzeptes, das die vier Bausteine der in der Ausbildungskonzeption des DFB vorgesehenen Inhalte in der Altersstufe der D-Junioren enthält. In diesem Alter beginnen die Spieler, die in den Altersstufen zuvor erworbenen Grundlagen mehr und mehr in ein „richtiges“ Fußballspiel zu übertragen und in einem erweiterten Zusammenspiel umzusetzen. Dies geschieht zunehmend im Rahmen taktischer Entscheidungen. Diese Arbeit soll helfen, die Bedeutung von Spielformen im Fußballtraining und in der Entwicklung junger Spieler zu verdeutlichen. Die hierin entwickelten Spielformen sollen eine Orientierung für das Fußballtraining im Verein aber auch in der Schule darstellen – aufgrund von Variationen auch für unter-schiedliche Leistungsgruppen.
INHALTSVERZEICHNIS
1. Einleitung
1.1 Themenwahl
1.2 Aufbau der Arbeit
2. Theoretische Grundlagen
2.1 Leitlinien der Ausbildungskonzeption des DFB
2.2 Inhalte der Ausbildungskonzeption des DFB
2.3 Grundlagenschulung: Ziele und Inhalte der D-Junioren
2.4 Spieldidaktische Prinzipien und Methodische Umsetzung
2.5 Sportliches Leitbild: Trends und Konsequenzen des DFB für das Grundlagentraining
2.6 Basisförderung Schule
2.7 Das Konzept TGfU - Spielformen statt Übungsformen
3. Inhaltsbausteine zum Spielverhalten mit Schwerpunkt D-Jugend
3.1 Baustein 1: Spielerische Konditionsschulung
3.2 Baustein 2: Systematisches Technik-Training
3.3 Baustein 3: Individualtaktische Grundlagen
3.4 Baustein 4: Fußballspielen mit Schwerpunkten und freies Spielen
4. Entwicklung der Spielformen
4.1 Erklärung zur Darstellung der Spielformen
4.1.1 Variationsmöglichkeiten und ihre Wirkungen
4.1.2 Allgemeine Begründung zur Auswahl der Spielformen
4.2 Spielformen Spielerische Konditionsschulung
4.3 Spielformen Systematisches Technik-Training
4.4 Spielformen Individualtaktische Grundlagen
4.5 Spielformen Fußballspielen mit Schwerpunkten und freies Spielen
5. Fazit
6. Literaturverzeichnis
Abbildungs-, Tabellenverzeichnis