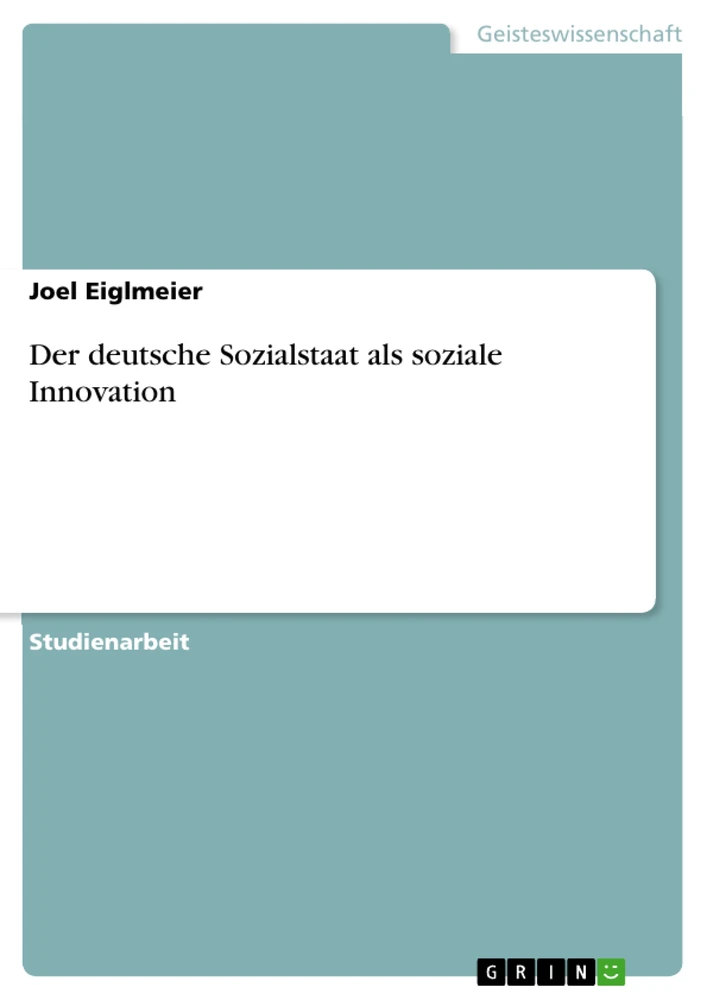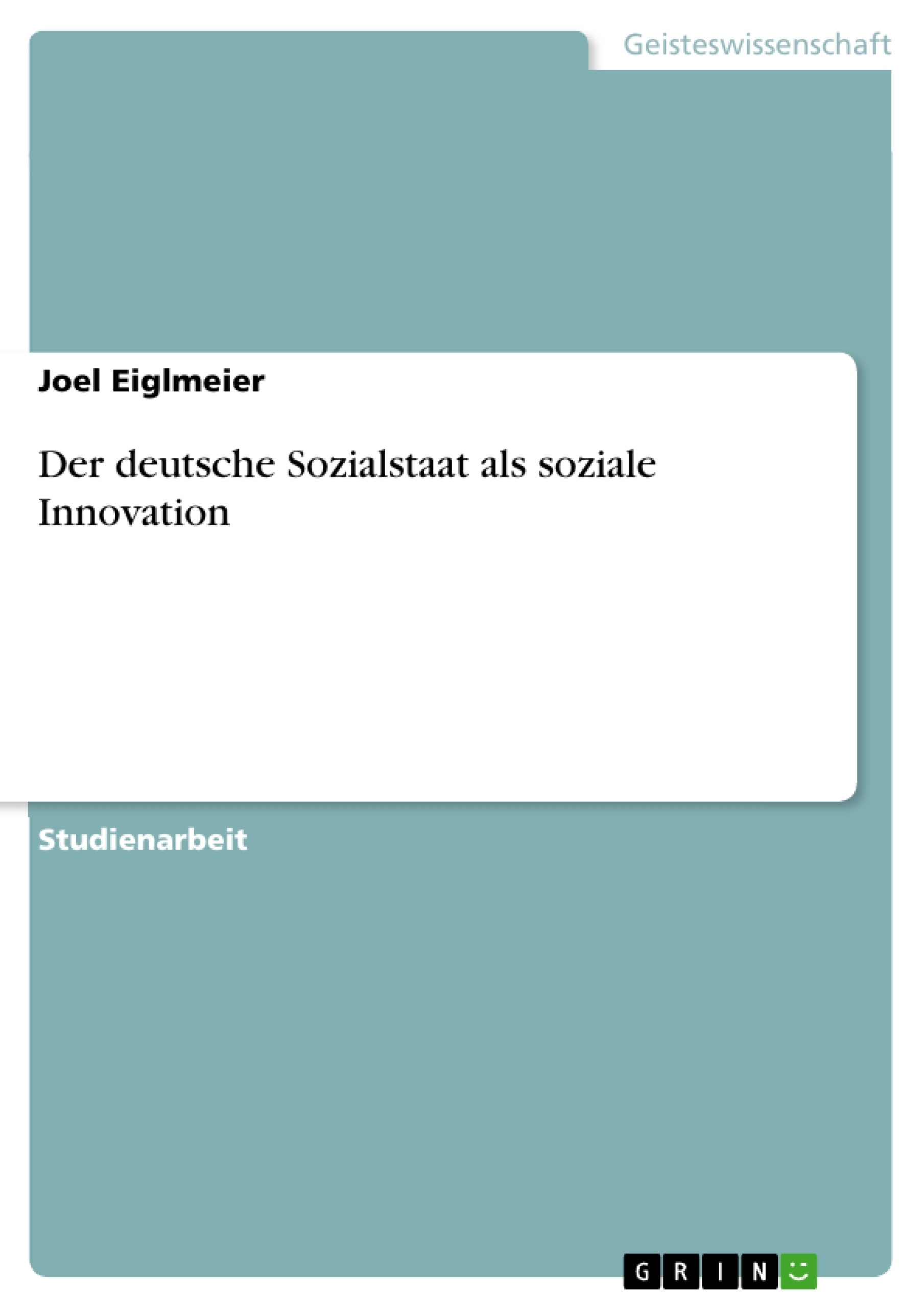Der Begriff der sozialen Innovation ist schwammig und weit gefasst, die Inhalte sozialer Innovationen sind dabei je nach wissenschaftlicher Couleur breit ausdifferenziert, weswegen es an einer einheitlichen Definition der sozialen Innovation fehlt. So beschreibt Zapf in seinem Aufsatz „Über soziale Innovationen“ sieben Ansätze zur Einordnung sozialer Innovationen, u.a. aus dem betriebswirtschaftlichen, sozialtechnologischen und politischen Bereich (dazu Zapf 1989). Jeder dieser Ansätze setzt den Fokus der Betrachtung sozialer Innovationen auf ein disziplinspezifisches Spektrum. Häufig werden soziale Innovationen dabei als Rand oder Folgeerscheinungen technischer Innovationen verstanden und beleuchten so nur Ausschnitte des sozialen Geschehens (dazu Aderhold/John 2005).
Im Jahr 2000 hat Katrin Gillwald mit ihrer Arbeit „Konzepte sozialer Innovationen“ eine umfangreiche Literaturanalyse der Thematik unternommen und damit verschiedene Ansätze der Innovationsforschung vorgestellt und zusammengeführt und wichtige Merkmale sozialer Innovationen herausgearbeitet, um den Begriff der sozialen Innovation fassbar zu machen.
In dieser Arbeit „Der deutsche Sozialstaat als soziale Innovation“ soll der Frage nachgegangen werden, ob der deutsche Sozialstaat den Kriterien einer sozialen Innovation entspricht und somit als soziale Innovation bezeichnet werden kann. Dazu werden im Folgenden einige Merkmale Gillwalds Konzepts sozialer Innovationen mit Hilfe Zapfs Definition der sozialen Innovation genutzt, um zwei markante Strukturen des deutschen Sozialstaates hin auf sozial-innovatorisches Potential zu untersuchen.
Vorerst wird aber in die Begrifflichkeiten sozialer Innovationen eingeführt, um einen eigenen Merkmalskatalog sozialer Innovation aufzustellen. Sodann wird der deutsche Sozialstaat mit seinen Kernelementen der Sozialhilfe und der Sozialversicherung vorgestellt, um ihn im Folgenden mit dem Merkmalskatalog sozialer Innovationen zu untersuchen.
INHALT
1. EINLEITUNG
2. SOZIALE INNOVATIONEN
2.1 MERKMALE SOZIALER INNOVATIONEN
3. DER SOZIALSTAAT
3.1 HERLEITUNG DES BEGRIFFS SOZIALSTAAT
4. DIE INHALTE DEUTSCHER SOZIALSTAATLICHKEIT
4.1 BETRACHTUNG DER SOZIALHILFE
4.1.1 DIE ENTWICKLUNG DER SOZIALHILFE
4.1.2 MERKMALE SOZIALER INNOVATIONEN UND DIE SOZIALHILFE
4.2 BETRACHTUNG DER SOZIALVERSICHERUNG
4.2.1 DIE ENTWICKLUNG DER SOZIALVERSICHERUNG
4.2.2 MERKMALE SOZIALER INNOVATIONEN UND DIE SOZIALVERSICHERUNGEN
5. FAZIT
6. KRITIK
7. LITERATUR