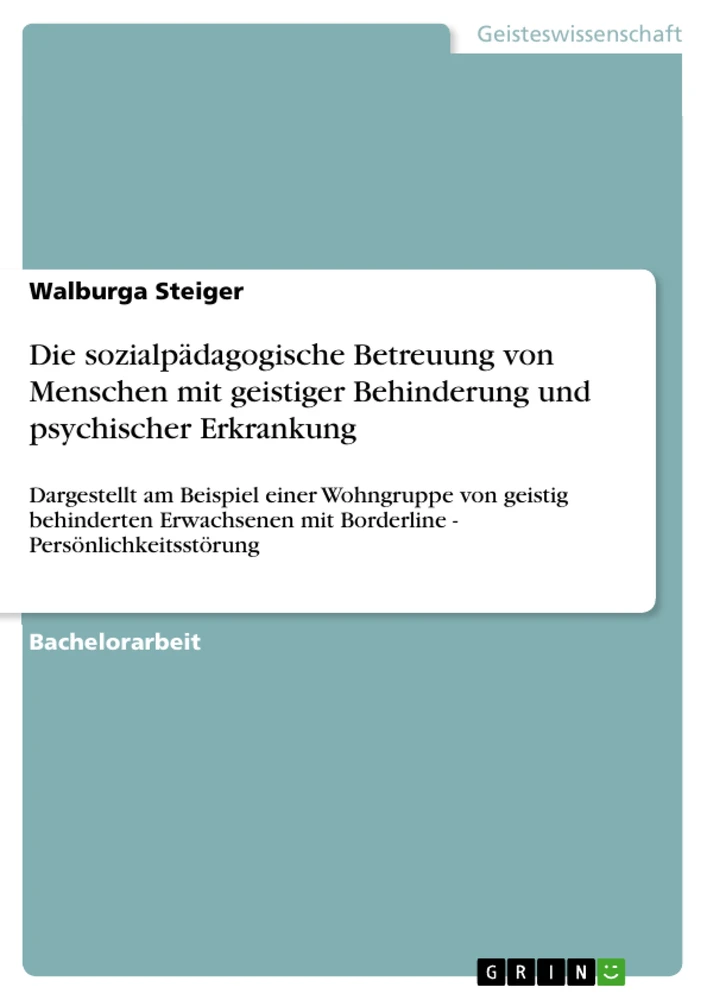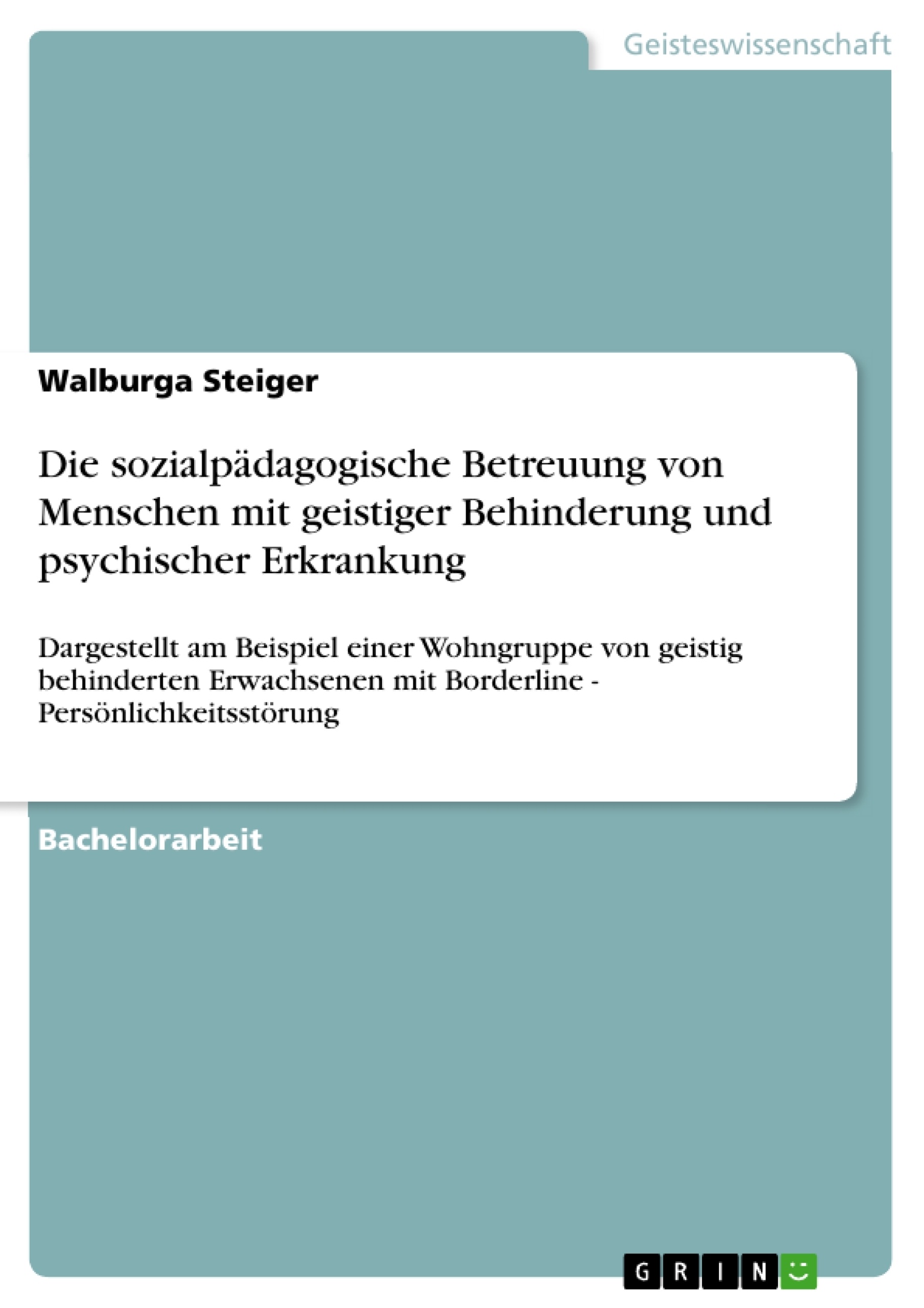In dieser Arbeit geht es um die Frage, wie sozialpädagogische Betreuung geistig behinderter Menschen mit psychischer Erkrankung heute in der Praxis aussieht.
Angesichts immer knapper werdender öffentlicher Mittel und politischer Entscheidungen, die von Sparzwang geprägt sind, ist die Soziale Arbeit gefordert, hellhörig und aufmerksam zu sein, um zu warnen und zu handeln.
Ziel der Arbeit ist die Beschreibung, Betrachtung und Bewertung aktueller sozialpädagogischer Betreuung in einer Wohngruppe einer Behinderteneinrichtung von Regens Wagner.
Zunächst werden einige Grundlagen dargestellt: Wie wird geistige Behinderung definiert, nach welchen Systemen wird diagnostiziert und wie werden psychische Störungen bei geistig behinderten Personen umrissen? Was versteht man unter einer Borderline – Persönlichkeits – Störung?
Der nächste Punkt behandelt sozialarbeiterische Prinzipien und pädagogische Konzepte in der Arbeit mit geistig behinderten psychisch kranken Menschen. Er stellt dar, welches Menschenbild der Arbeit zugrunde liegt und beschreibt den Alltag in einer Wohngruppe.
Weiterhin werden sozialpädagogische Methoden und Interventionsmöglichkeiten erklärt.
Auch wird beschrieben, wie mit Krisen umgegangen werden kann und welche Anforderungen an die Mitarbeiter in einer Wohngruppe gestellt werden.
Das Fazit schließlich befasst sich mit den zu ziehenden Schlussfolgerungen und mit der Frage, inwieweit die sozialpädagogische Betreuung von geistig behinderten Menschen sie in ihrer Weiterentwicklung zu fördern vermag sowie mit den Anforderungen an Staat und Gesellschaft.
Bei der Abfassung dieser Arbeit habe ich die männliche und weibliche Schreibweise abwechselnd gewählt, um beiden Geschlechtern gerecht zu werden.
Inhaltsverzeichnis:
1. Summary
2. Einleitung
3. Geistige Behinderung – Intelligenzminderung
3.1. Definitionen psychischer Störungen bei geistig behinderten Menschen
3.2. Diagnostik und Diagnosesysteme
3.3. Die Borderline-Persönlichkeitsstörung
4. Pädagogische Konzepte in Wohngruppen mit geistig behinderten Erwachsenen und Borderline – Persönlichkeitsstörung
4.1. Sozialarbeiterische Prinzipien und Konzepte
4.1.1. Menschenbild: Würde und Wert des Menschen, Wertschätzung des Individuums
4.1.2. Autonomie, Individualisierung
4.1.3. Lebensweltorientierung
4.1.4. Inklusion
4.2. Lebensweltorientierte Arbeit mit Behinderten
4.2.1. Prinzipien der Lebensweltorientierung
4.2.2. Lebenswelt im institutionalisierten Alltag
4.2.3. Das Normalisierungsprinzip
4.3. Der Alltag in einer Wohngruppe
4.3.1. Rahmenbedingungen
4.3.2. Pflege
4.3.3. Hausarbeit, lebenspraktische Assistenz
4.3.4. Freizeitgestaltung
4.3.5. Seelsorgerische Betreuung
4.3.6. Allgemeine Lebensberatung, Bildungsassistenz
4.3.7. Psychosoziale Lebenshilfe und Körperliche Aktivierung
4.3.8. gesellschaftliche Integrationshilfe, kulturelle Partizipation
4.4. Pädagogischer Umgang bei Borderline – Störungen
4.4.1. Pädagogische Prinzipien
4.4.2. Sozialpädagogische Methoden und Interventionen
4.4.3. Umgang mit Krisen
4.5. Anforderungen an die Mitarbeiterinnen einer Wohngruppe
4.5.1. Umgang mit Überforderung und Hilflosigkeit
4.5.2. Selbstreflexion, Reflexion im Team
4.5.3. Selbstsorge: Seelsorge auch für die eigene Seele
5. Fazit
6. Literaturverzeichnis