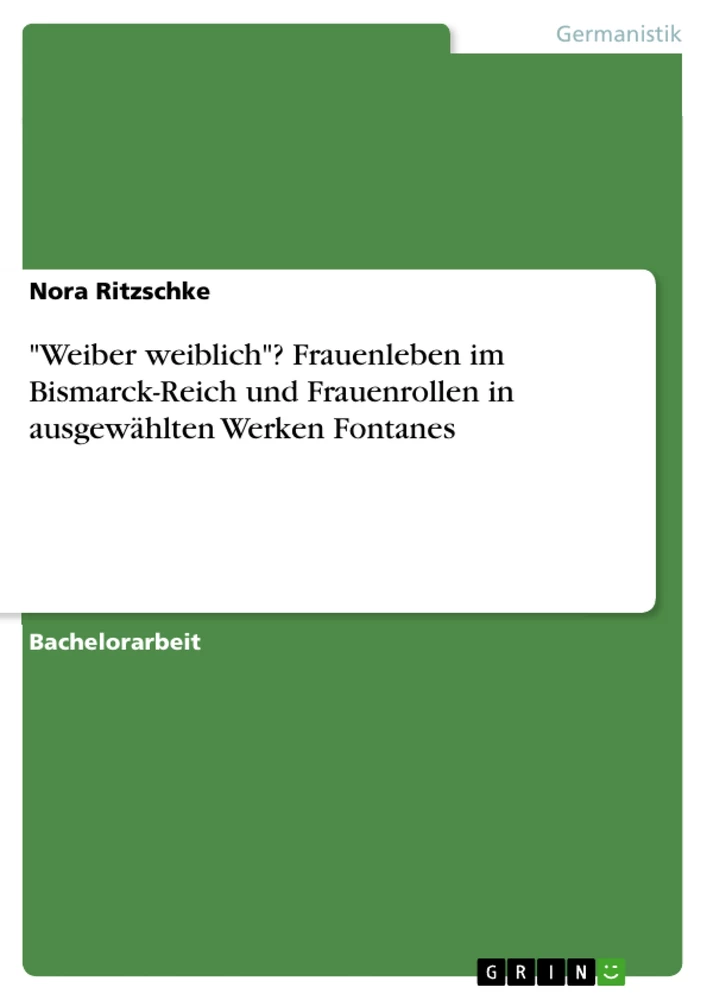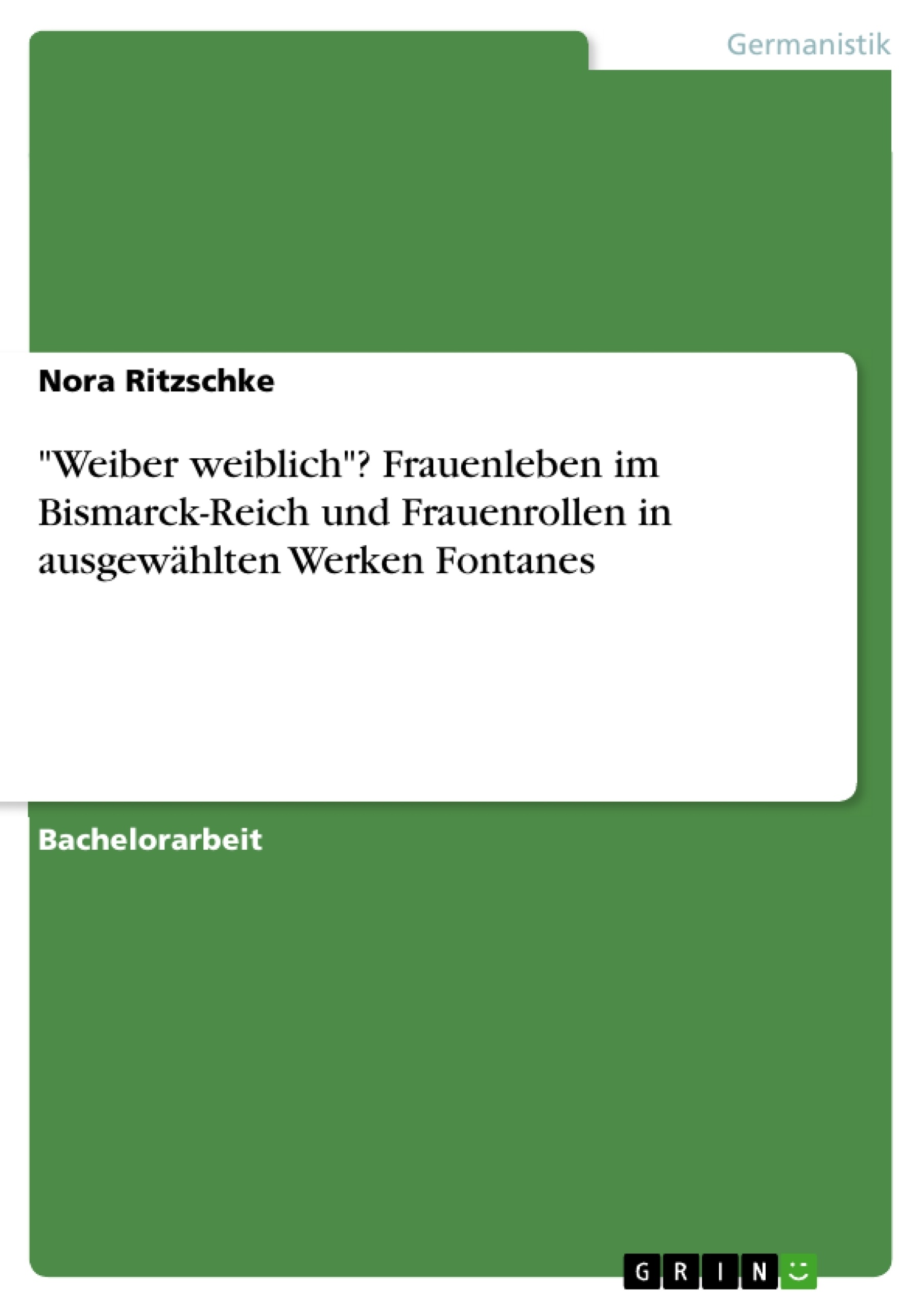Flaubert, Tolstoi, Ibsen - große Namen prägen die Erzählliteratur des 19. Jahrhunderts. Eines haben die bedeutendsten Werke dieser drei Schriftsteller gemeinsam: Die Helden ihrer Werke sind Frauen. Sie alle geraten in einen Konflikt mit der Gesellschaft, indem sie versuchen, sich aus einem äußerst beschränkten Lebenskreis und der patriarchalischen Vorherrschaft der Männer zu befreien. Sie alle leiden unter machthungrigen, emotionslosen Ehepartnern und begeben sich auf die Suche nach ihrem individuellen Glück. Nur Nora überlebt ihre unglückliche Ehe, befreit sich und ist in der Lage, die geltenden Moralvorstellungen und Konventionen in Frage zu stellen: „‚Ich muß mich davon überzeugen, wer recht hat, die Gesellschaft oder ich.‘“ Auch Fontane schließt sich dieser Thematik an. Das bekannteste Beispiel ist Effi Briest: Durch eine Affäre versucht sie, aus ihrer unglücklichen Ehe mit dem deutlich älteren Geert von Innstetten auszubrechen. Als dieser davon erfährt, wird sie von Familie und Gesellschaft verstoßen und stirbt. Ein ähnliches Schicksal widerfährt auch Melanie van der Straaten, die sich die gleiche Frage wie Nora Helmer stellt und es schafft, sich über die gesellschaftlichen Grenzen hinwegzusetzen. Cécile, eine wunderschöne junge Frau, hat keinen Ehebruch begangen, sondern war in der Vergangenheit die Mätresse eines Fürsten. Wie Effi stirbt auch sie, da sie aufgrund der fragwürdigen Moralvorstellungen nicht in der Lage ist, ihre Geschichte hinter sich zu lassen. Lene und Stine, zwei Arbeiterinnen, müssen ebenfalls ihre Erfahrungen mit Konventionen und Gesellschaft machen: Zugunsten dieser geben sie ihre Liebe auf. Während sich Lene im gleichen Stand verheiratet, stirbt Stine ebenso wie viele ihrer Vorgängerinnen und Nachfolgerinnen.
Die fünf Frauen und zwei weitere Figuren aus Fontanes Oeuvre sind Thema dieser Arbeit. Sie alle sind sich ähnlich. Die einen teilen ihr Schicksal, die anderen haben ein gemeinsames Ende, wobei alle Nora Helmers Frage nachgehen: Wer hat Recht, sie oder die Gesellschaft?
Inhaltsverzeichnis
1 „Ich muß mich davon überzeugen, wer recht hat, die Gesellschaft oder ich“ - Einleitung
2 Die Stellung der Frau im Bismarck-Reich
2.1 Rechtsstellung der Frau im Preußischen Allgemeinen Landrecht
2.2 ‚Weiber weiblich, Männer männlich‘ – Frauen in der Gesellschaft
3 Frauenbilder in Fontanes Werken
3.1 Fontanes Frauenbild
3.2 „[…] die Geschichte der Frauen ist meist viel interessanter“ - Einige Romanfiguren
3.2.1 L’Adultera - Melanie van der Straaten und Effi Briest
3.2.2 Kranke Schönheit - Cécile
3.2.3 Einfache Leben - Lene und Stine
3.2.4 „Nebenfiguren sind immer das Beste“ - Frau Dörr und Pauline Pittelkow
3.3 Zwei, drei oder mehr Frauentypen?
4 Fontane - Realist und Gesellschaftskritiker? Vergleich von Realität und Werken
5 Fazit
6 Literaturverzeichnis