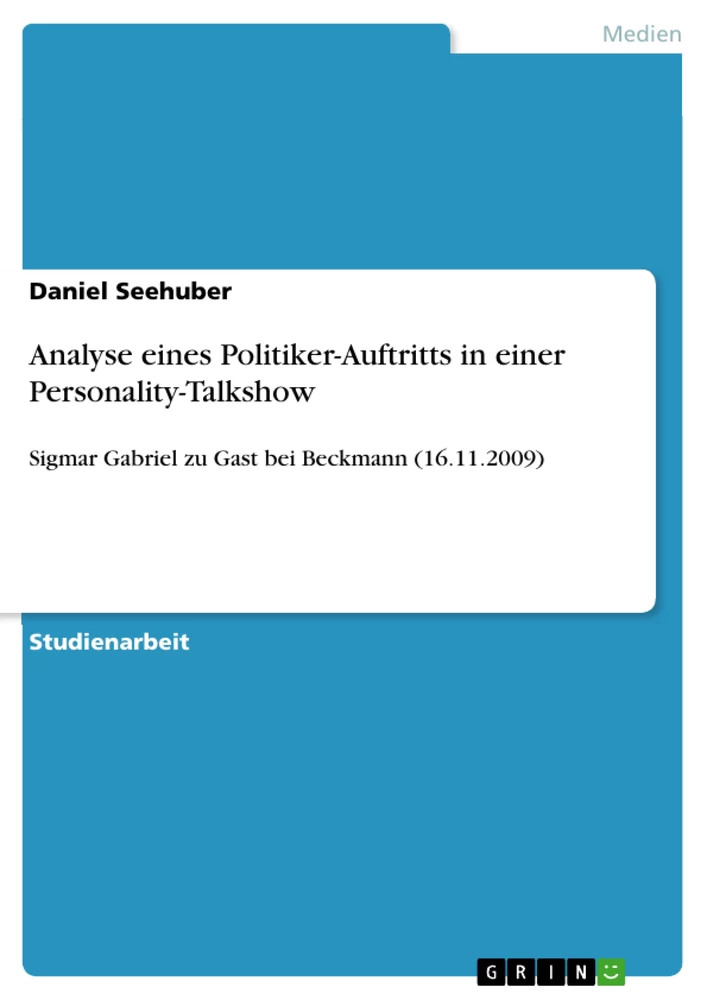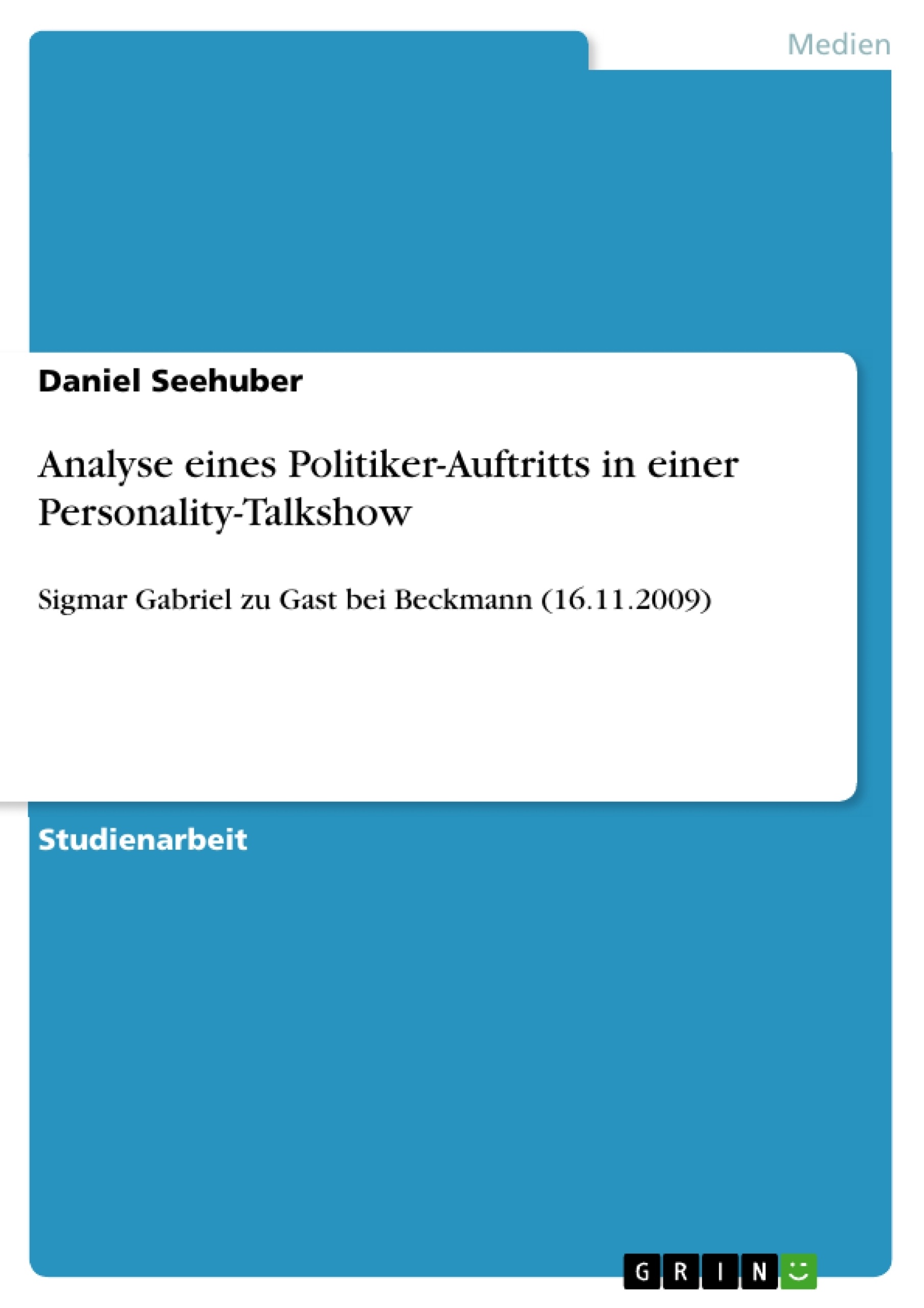Die von Reinhold Beckmann moderierte Unterhaltungssendung Beckmann wird seit Anfang
1999 im Spätabendprogramm der ARD ausgestrahlt und erreicht seit Jahren konstant
Einschaltquoten von mehr als einer Million. Im Jahr 2001 rezipierten durchschnittlich gar
rund 1,8 Millionen Menschen die Sendung, was einen Marktanteil von knapp 16 Prozent
bedeutete (vgl. Schultz 2002: 186). Im Mittelpunkt der jeweils etwa 75 Minuten langen
Sendungen stehen „prominente Gäste, aber auch Menschen, die nicht im Rampenlicht stehen
und eine außergewöhnliche und bewegende Lebensgeschichte haben“ (Frank Schulze
Kommunikation 2012). Die Sendungen haben zwar mitunter ein Rahmenthema, dennoch ist
Beckmann weniger als Debatten- als vielmehr als Personality-Talkshow einzustufen, bei der
der Fokus auf der Darstellung von Persönlichkeiten liegt und die Spannung des Zuschauers
„aus der farbigen, pointenreichen Präsentation von Gästen“ (Plake 1999: 32) resultiert.
Aufgrund dieser Ausrichtung und einer damit verbundenen tendenziellen Ausklammerung
von heiklen politischen Debatten bieten Formate wie Beckmann für politische Akteure „ein
attraktives Forum zur massenwirksamen Selbstdarstellung, ohne dass damit größere Gefahren
verbunden wären“ (Schultz 2002: 189). Indem sie persönliche Anekdoten erzählen, können
sich Politiker hier einerseits als volksnahe Menschen inszenieren; andererseits besteht die
Möglichkeit, indirekt politische Kommunikation zu betreiben, wenn Anekdoten „am Rande
mit Kommentaren zur aktuellen Politik amalgamiert werden“ (Schultz 2002: 183).
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1: Das Format Beckmann
Kapitel 2: Beckmann vom 16.11.2009
2.1 Der Politiker Sigmar Gabriel
2.2 Kontextinformationen zur Sendung
2.3 Rahmen/Rahmung der Sendung
2.4 Analyse des Auftritts von Sigmar Gabriel
Kapitel 3: Zusammenfassung/Gesamtrahmung des Auftritts
Literaturverzeichnis
Filmverzeichnis