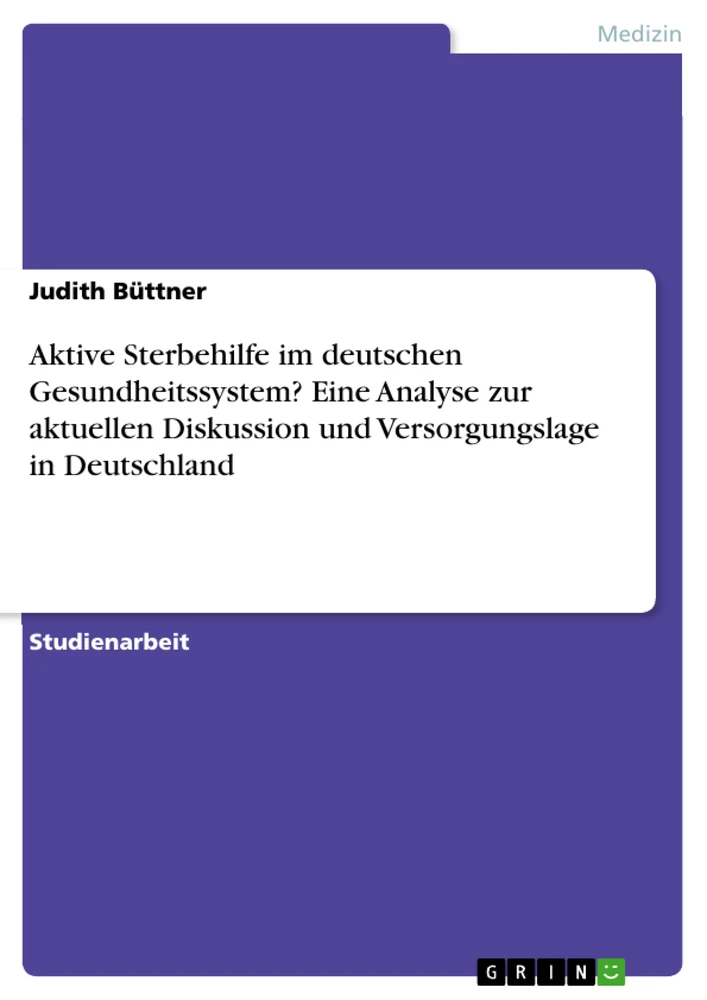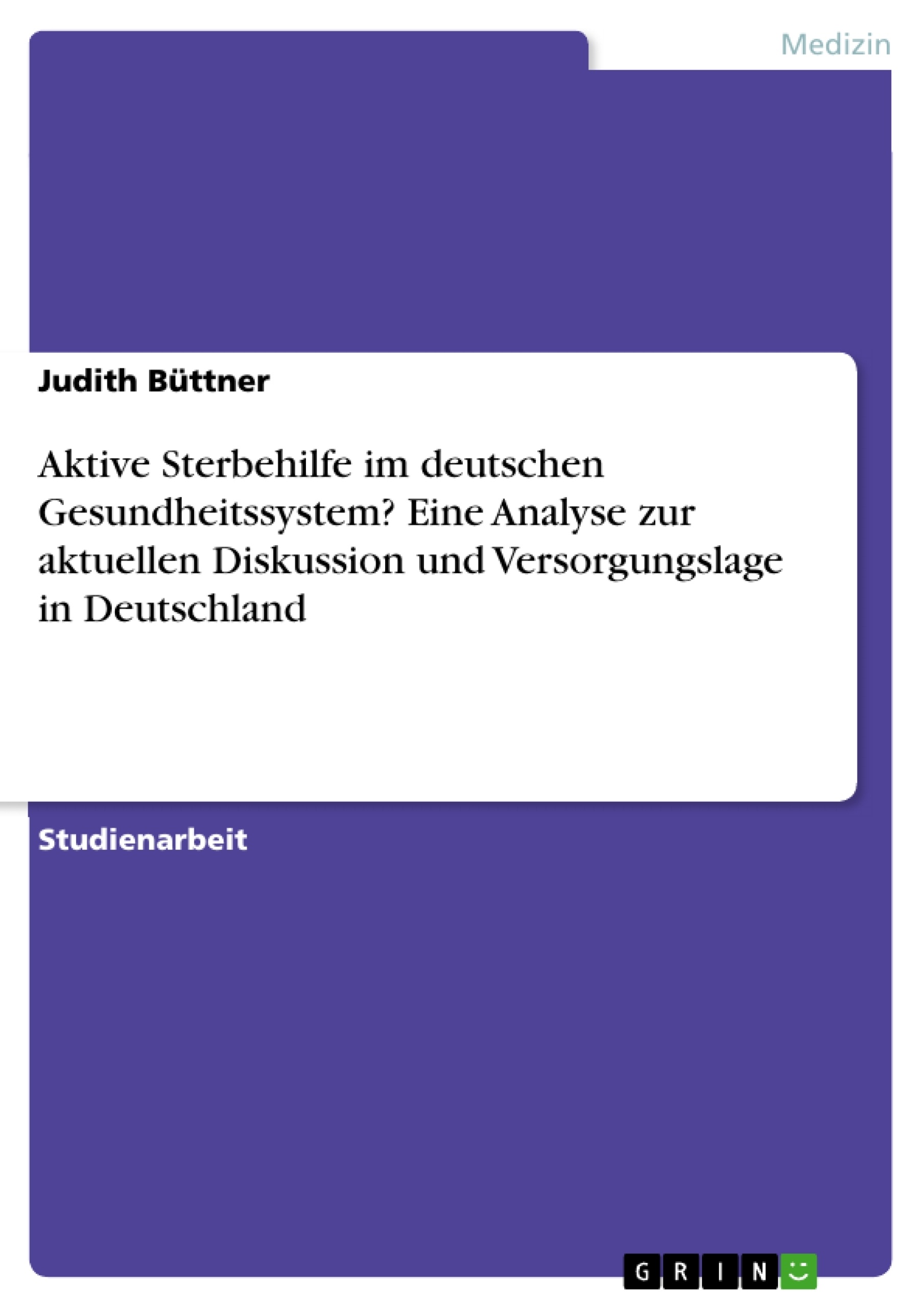„Du sollst nicht töten.“ , das wohl berühmteste Gebot der göttlichen Verhaltensweisungen, das die Menschen in ihrer Existenz begleitet und auf die moralischen und ethischen Grundsätze des gesellschaftlichen Zusammenlebens Einfluss nimmt. Und so ist dieses Gebot tief in unserem Innersten verwurzelt und umso heiliger in Friedenszeiten, als dieses Gebot durch Kriege und Gewalt erschüttert und die Menschheit vor ihre Abgründe gestellt wurde.
Ziel der Hausarbeit ist es, durch die Betrachtung und Analyse aller relevanten Einflüsse die idealen Bedingungen zur Etablierung der aktiven Sterbehilfe in das deutsche Gesundheitssystem herzuleiten und zu hinterfragen, ob und wann diese Bedingungen in der Realität erreicht und umgesetzt werden können. Wird es in Deutschland die aktive Sterbehilfe per Gesetz geben?
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
2 Formen der Sterbehilfe und Sterbebegleitung
2.1 Aktive Sterbehilfe
2.2 Passive und indirekte Sterbehilfe
2.3 Palliativmedizin und Hospizarbeit
3 Aktive Sterbehilfe in Deutschland
3.1 Aktuelle Situation
3.2 Argumente gegen die aktive Sterbehilfe
3.3 Argumente für die aktive Sterbehilfe
4 Methode und Material zur Umsetzung der Hausarbeit
5 Ansätze zur Etablierung der aktiven Sterbehilfe
5.1 Gesellschaftlicher Wertewandel
5.2 Legalisierung der aktiven Sterbehilfe
5.3 Handlungskodex für Mediziner
5.4 Kontroll- und Schutzmechanismen
6 Kritische Reflexion – aktive Sterbehilfe im deutschen Gesundheitssystem?
7 Zusammenfassung
8 Literaturverzeichnis
9 Verzeichnis der Internetquellen