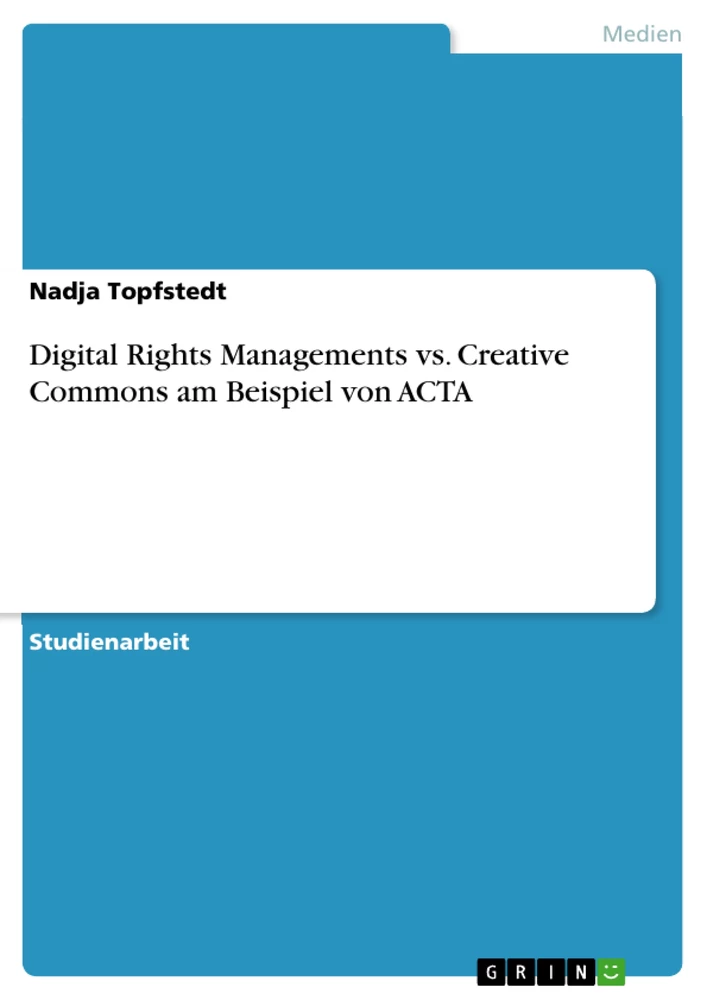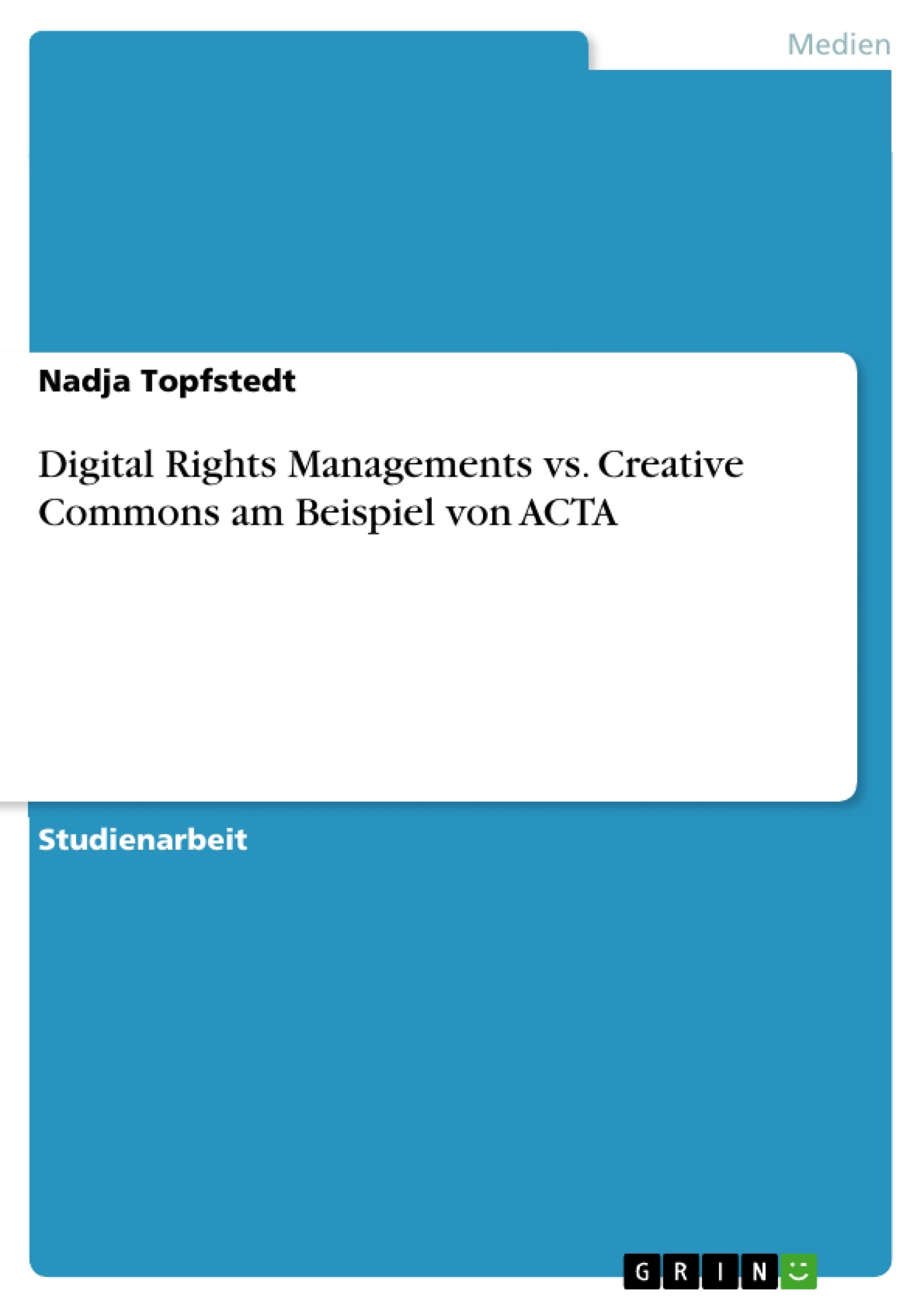„Digitalisierte Inhalte sind das Lebenselixir des Internets.“ (Arlt 2006: S. 1
Derzeit werden in den Medien sehr viele Fragen zum Urheberrecht in Bezug auf digitale Inhalte gestellt. Schuld daran sind die geplanten Abkommen ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) in elf Staaten sowie SOPA (Stop Online Piracy Act) und PIPA (Protect IP Act) in den Vereinigten Staaten. Darin sollen Verstöße gegen die Gesetze der Produkt- und Markenpiraterie fest verankert werden. Ein entscheidender Vorteil von digitalen zu analogen Medieninhalten ist es, dass diese in ein und demselben technischen Format dargestellt und gespeichert werden können. Christian Arlt be-trachtet z. B. Kopien, damit verdeutlicht er, dass digitale Kopiervorlagen nach ihrer Vervielfältigung immer die gleiche Qualität besitzen wie das Original. Währenddessen nimmt die Qualität beim analogen Original tendenziell ab, wenn zu viele Kopien gezo-gen werden. Dies ist einer der Gründe, warum die Piraterie zugenommen hat. Digitale Kopien kann jeder erstellen und diese stehen kostengünstig und weltweit zur Verfü-gung. Warum also noch eine Musik-CD kaufen, wenn das Original in Kopie mit gleicher Qualität existiert (vgl. Arlt 2006: S. 5f.). Das Problem der Inhaltspiraterie ist bisher stärker im Musikbusiness vertreten, doch immer mehr überträgt es sich jetzt auch auf andere Inhalte. Schlimmster Fall, der eintreten kann, ist, dass letztendlich alle Beteilig-ten an der Situation verlieren. Dies würde so aussehen, dass die Rechteverwerter ihre Konsumenten durch Umsatzeinbußen mit einem eingeschränkten Produktangebot kon-frontieren. Die Vielfalt wird eingeschränkt, da die Anreize für eine Inhaltsproduktion nicht mehr existieren (vgl. Arlt 2006: S. 6f.). Dieses Problem soll durch das Abkommen ACTA gelöst werden, so dass einheitliche Regelungen über die Verwendung von digita-len Inhalten zur Verfügung stehen. Um die bestehenden Richtlinien von digitalen Inhal-ten näher zu verstehen, werden zu Beginn zwei Positionen vorgestellt. Zuerst das Digital Rights Management, welches im Urheberrecht integriert ist und die Creative Commons, die unterschiedliche Ansätze zum Umgang geistiger Werke verfolgen. Daraufhin wird auf den Sachverhalt der Europäischen Union und anderer Staaten mit ihrem geplanten internationalen Handelsabkommen ACTA eingegangen. Zum Schluss wird ein Ausblick auf möglichen Lösungen für das Problem der Urheberrechte von digitalen Inhalten gegeben und ein Fazit gezogen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Digital Rights Management
2.1. Begriffsdefinition nach Picot
2.2. Bedeutung des Urheberrechts
2.3. Umsetzung des Digital Rights Management
2.4. Vor- und Nachteile des Digital Rights Management
3. Creative Commons
3.1. Entstehung und Hintergrund
3.2. Creative Commons Lizenzen
3.2.1. Namensnennung CC BY
3.2.2. Namensnennung- Keine Bearbeitung CC BY-ND
3.2.3. Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen CC BY-SA
3.2.4. Namensnennung-Nicht-kommerziell CC BY-NC
3.2.5. Namensnennung-Nicht-kommerziell-Weitergabe unter gleichen Bedingungen CC BY-NC-SA
3.2.6. Namensnennung-Nicht-kommerziell-Keine Bearbeitung CC BY-NC-ND
3.2.7. CC0 - No Rights Reserved
3.3. Verwendung von CC-Lizenzen
3.4. Vor- und Nachteile von Creative Commons
4. ACTA
4.1. Entstehung und Hintergrund
4.2. ACTA-Protestbewegung
4.3. Rückblick und aktuelle Situation zu ACTA
4.4. Ausblick und mögliche Lösungen
5. Fazit
Literaturverzeichnis