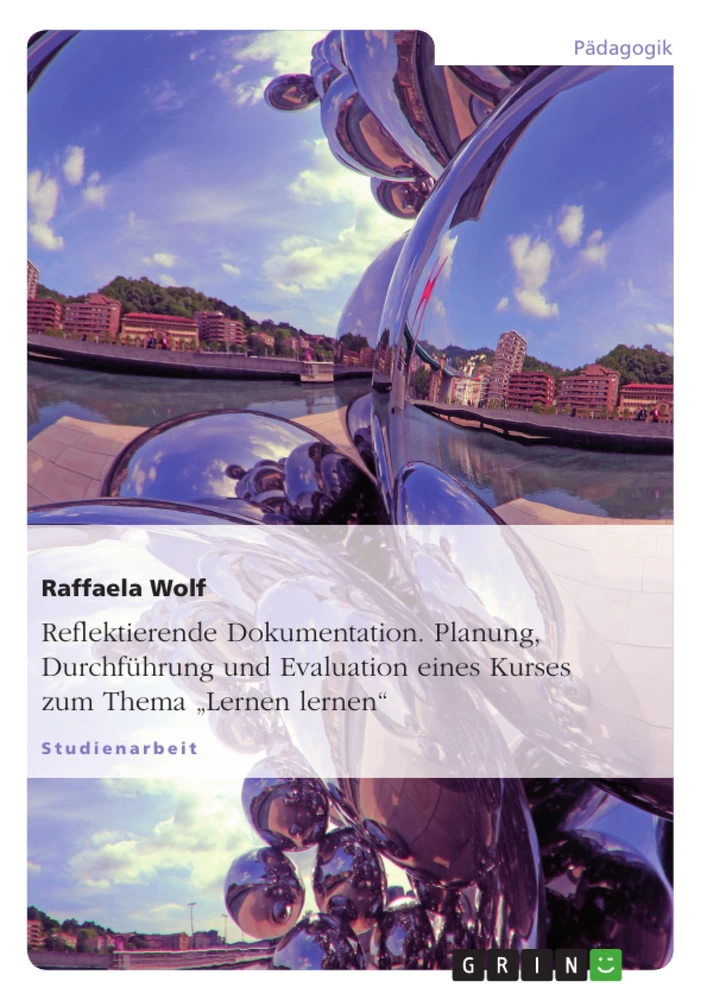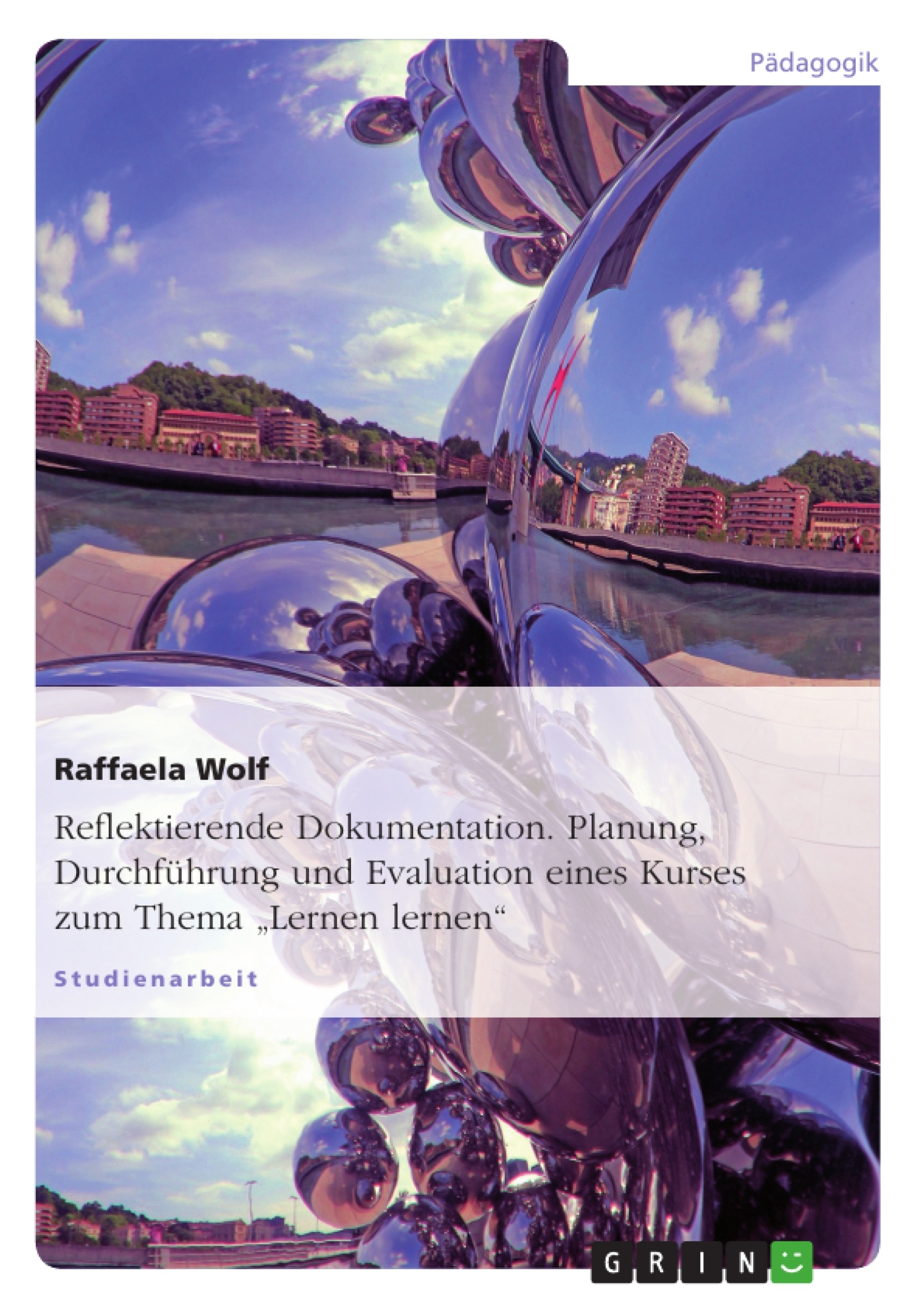Das Ziel der vorliegenden Arbeit besteht darin, die Planung, Durchführung und Evaluation eines Projekts im Zuge des modulbegleitenden Praktikums reflektie-rend zu dokumentieren. Konkret wurde das im Studiengang ‚Bildungswissen-schaft’ erworbene bildungstheoretische Wissen in die Praxis übertragen und im Rahmen eines lernmethodischen Kurses zum Thema „Lernen lernen“ zur An-wendung gebracht.
Dehnbostel spricht von Reflexivität als einer zentralen Kategorie, deren Wichtig-keit entsprechend den „wachsenden Innovations- und Kommunikationserforder-nissen in der Arbeit“ (Dehnbostel, 2008, S. 38) zunimmt. In der nachfolgenden Dokumentation wird versucht, die Arbeits- und Gestaltungsprozesse während des Praktikums und insbesondere während der einzelnen Projektphasen sowohl strukturell als auch selbstreflektierend festzuhalten.
Dabei spiegelt der Aufbau der Arbeit das Zusammenspiel bildungstheoretischer Hintergründe und bildungspraktischer Umsetzung wider: Im 2. Kapitel erfolgt eine Beschreibung der Einrichtung, in der das Praktikum absolviert wurde sowie der Rahmenbedingungen, unter denen das Projekt geplant und durchgeführt wurde, gefolgt von Informationen über die Zielgruppe. Das 3. Kapitel reflektiert die ein-zelnen Projektphasen von der Planung über die Durchführung bis hin zur Evalua-tion und gibt einen Einblick in die Zielsetzungen des Lernmethodik-Kurses und die Methoden, die zu deren Erreichen angewandt wurden. Die darauf folgenden drei Kapitel widmen sich den Begriffen Projektmanagement, Qualitätssicherung und Evaluation. Diese werden zunächst jeweils theoretisch erläutert und an-schließend auf ihre Bedeutung für das konkrete Vorhaben und ihre Anwendbar-keit hin untersucht. Abschließend werden im Fazit die gewonnenen Erkenntisse rückblickend zusammengefasst und deren Anwendungspotential in der Zukunft beleuchtet.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Praktikumsstelle
2.1 Beschreibung der Praktikumsstelle
2.2 Rahmenbedingungen des Projekts
2.3 Eingrenzung und Beschreibung der Zielgruppe
3 Handlungsablauf
3.1 Planung
3.2 Durchführung
3.3 Auswertung
4 Projektmanagement
4.1 Definition
4.2 Bezug zum Praktikum
5 Qualitätssicherung
5.1 Theoretische Bezüge
5.2 Praktische Durchführung
6 Evaluation
6.1 Theoretische Bezüge
6.2 Projekt-Evaluation
7 Fazit und Ausblick
Literaturverzeichnis