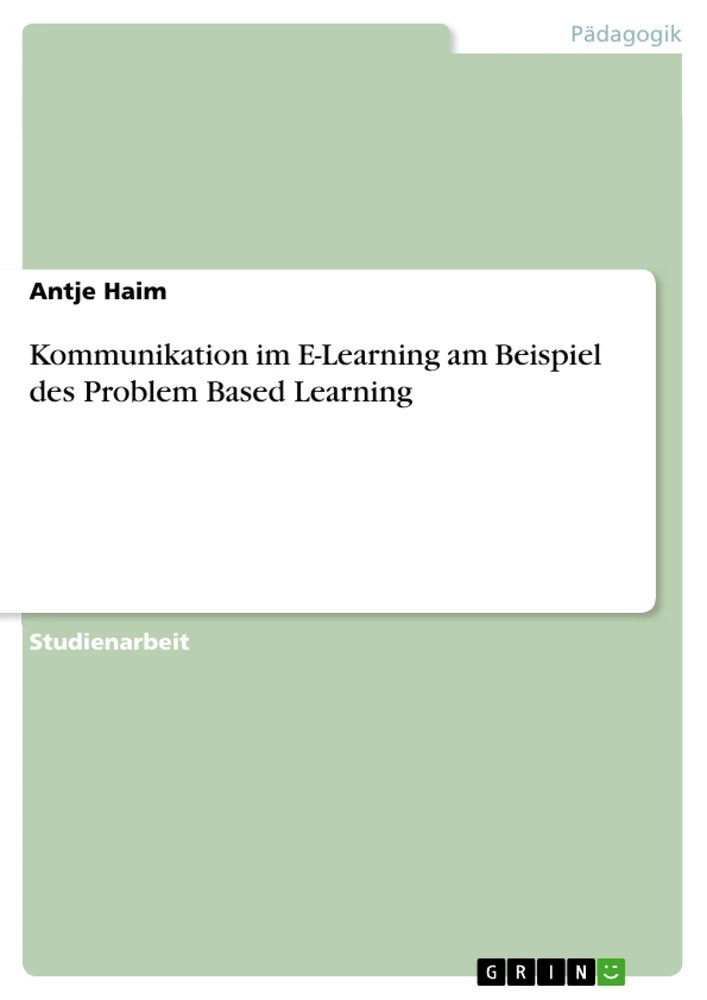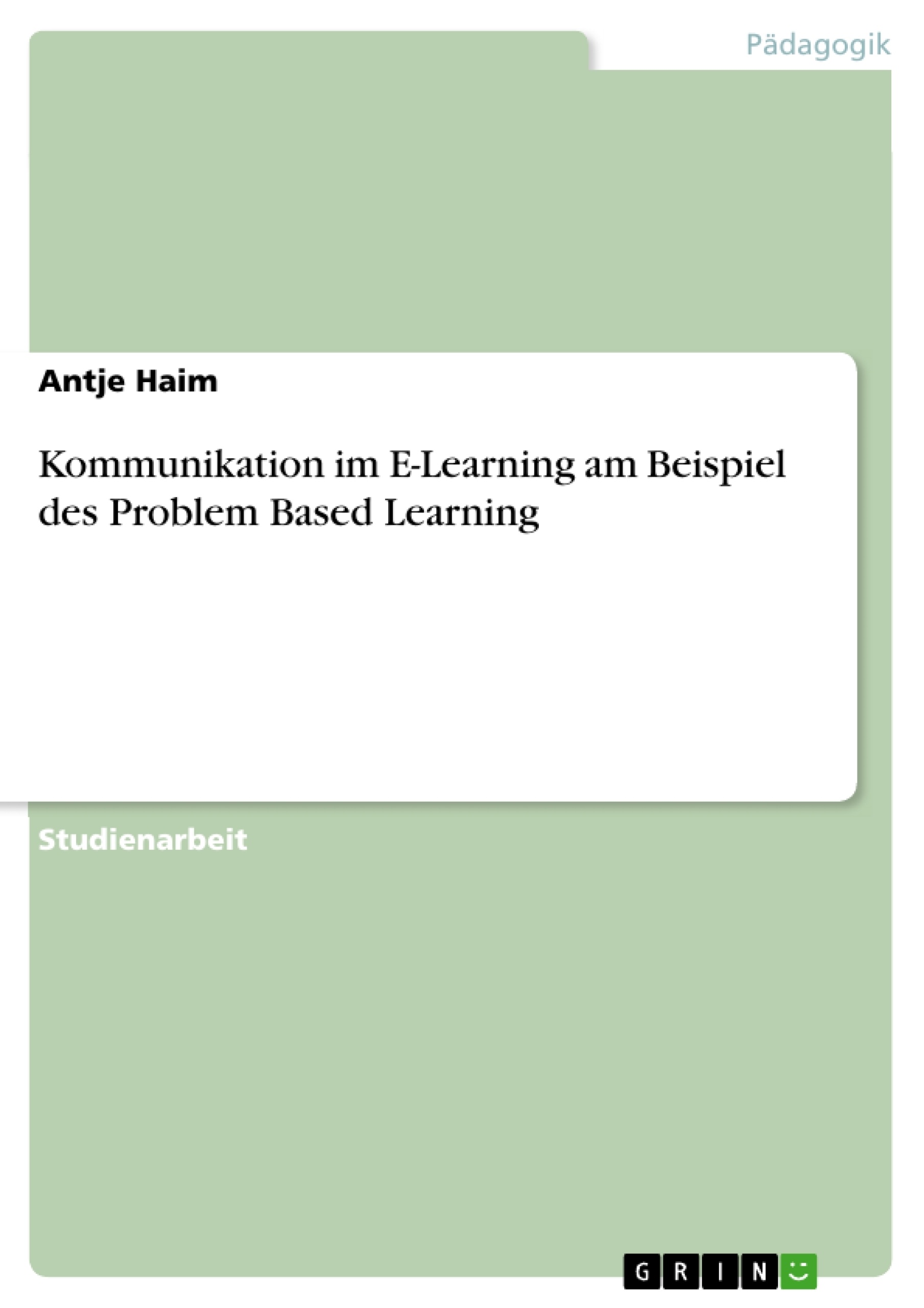Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Grundlagen
2.1 Kommunikation
2.1.1 Computervermittelte Kommunikation
2.1.2 Synchrone und asynchrone Kommunikationsmedien
2.1.3 Soziale Präsenz bei computervermittelter Kommunikation
2.2 Wissenskommunikation
2.2.1 Medienkompetenz
2.2.2 Medienwahl
2.3 Problem-Based Learning
2.3.1 Lerntheoretische Bezüge
2.3.2 Phasen im Problem-Based Learning
3 Einsatz von Kommunikationsmedien im Problem-Based Learning
3.1 Bewertungskriterien
3.2 Medienwahl im Problem-Based Learning
3.3 Konsequenzen für die Kommunikationsprozesse
4 Fazit
1 Einleitung
...An Problemen ausgerichtetes Lernen findet in den verschiedensten Ebenen der Aus- und Weiterbildung Anwendung, da Lernen anhand authentischer Probleme einen aktiven und individuellen Konstruktionsprozess fördert. Auch in der beruflichen Weiterbildung fordern zunehmend komplexere und situativ variierende Anforderungen weitreichende Lern- und Erfahrungsprozesse, um entsprechendes Expertenwissen aufbauen und anwenden zu können... Um der zunehmenden Dynamisierung und Globalisierung der Arbeitswelt zu begegnen, braucht es Lernumgebungen, die es ermöglichen, „Wissen und Fähigkeiten räumlich und zeitlich unabhängig zu vermitteln“(Dittler & Jechle 2002, S.420). E-Learning kommt dabei vermehrt zum Einsatz... Grundsätzlich können Kommunikationsmedien positive und negative Eigenschaften haben (Zumbach 2007, S.245f.), sodass ein besonderes Augenmerk auf die geeignete Medienwahl gelegt werden muss.
In dieser Arbeit soll die Bedeutung von Kommunikation im E-Learning anhand von Problem-Based Learning (PBL) näher betrachtet werden und der Frage, „ob die Medienwahl die Kommunikationsprozesse in computerunterstützten Lernumgebungen beeinflussen“ nachgegangen werden. Zunächst werden die Grundlagen computervermittelter Kommunikation und die zum Einsatz kommenden Medienarten, sowie die soziale Präsenz im E-Learning dargestellt (Kapitel 2.1). Die Wis-senskommunikation und die Medienkompetenz, sowie deren Bedeutung für die Medienwahl werden in Kapitel 2.2 beschrieben. Des Weiteren werden Theorien zur Medienwahl näher betrachtet, die als Grundlagen für die Bewertungskriterien herangezogen werden. In Kapitel 2.3 wird das PBL unter lerntheoretischen As-pekten und deren Phasen beschrieben. Die Bedeutung der Medienwahl für Kommunikationsprozesse im PBL, Bewertungskriterien und entsprechende Konsequenzen werden im Kapitel 3 bearbeitet. Abschließend erfolgt ein Fazit.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
2 Grundlagen
2.1 Kommunikation
2.1.1 Computervermittelte Kommunikation
2.1.2 Synchrone und asynchrone Kommunikationsmedien
2.1.3 Soziale Präsenz bei computervermittelter Kommunikation
2.2 Wissenskommunikation
2.2.1 Medienkompetenz
2.2.2 Medienwahl
2.3 Problem-Based Learning
2.3.1 Lerntheoretische Bezüge
2.3.2 Phasen im Problem-Based Learning
3 Einsatz von Kommunikationsmedien im Problem-Based Learning
3.1 Bewertungskriterien
3.2 Medienwahl im Problem-Based Learning
3.3 Konsequenzen für die Kommunikationsprozesse
4 Fazit
Literaturverzeichnis