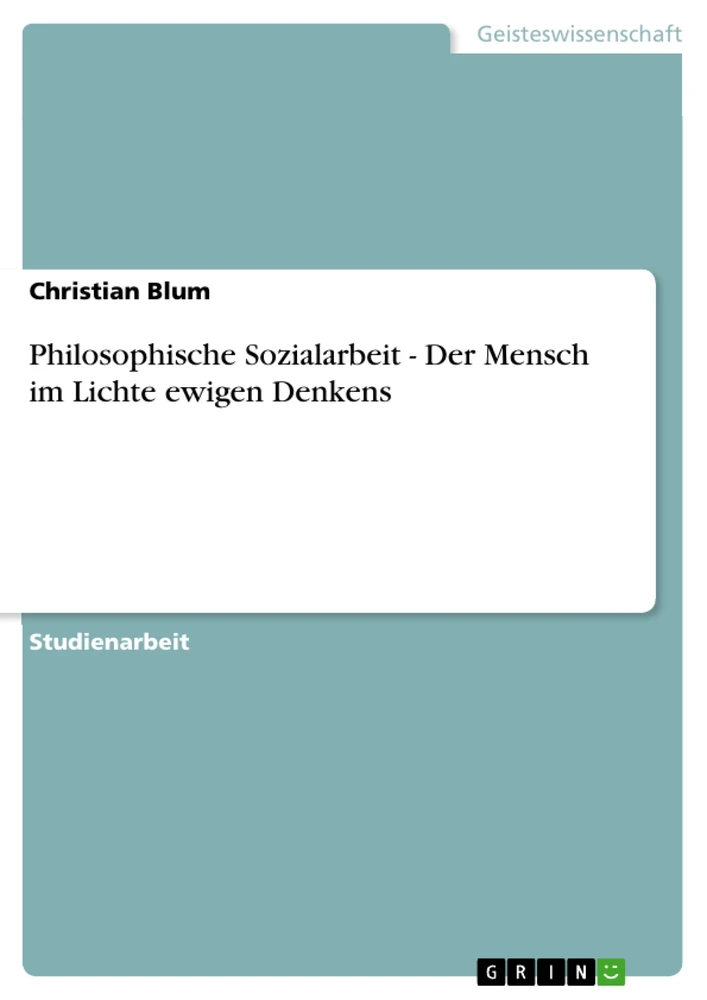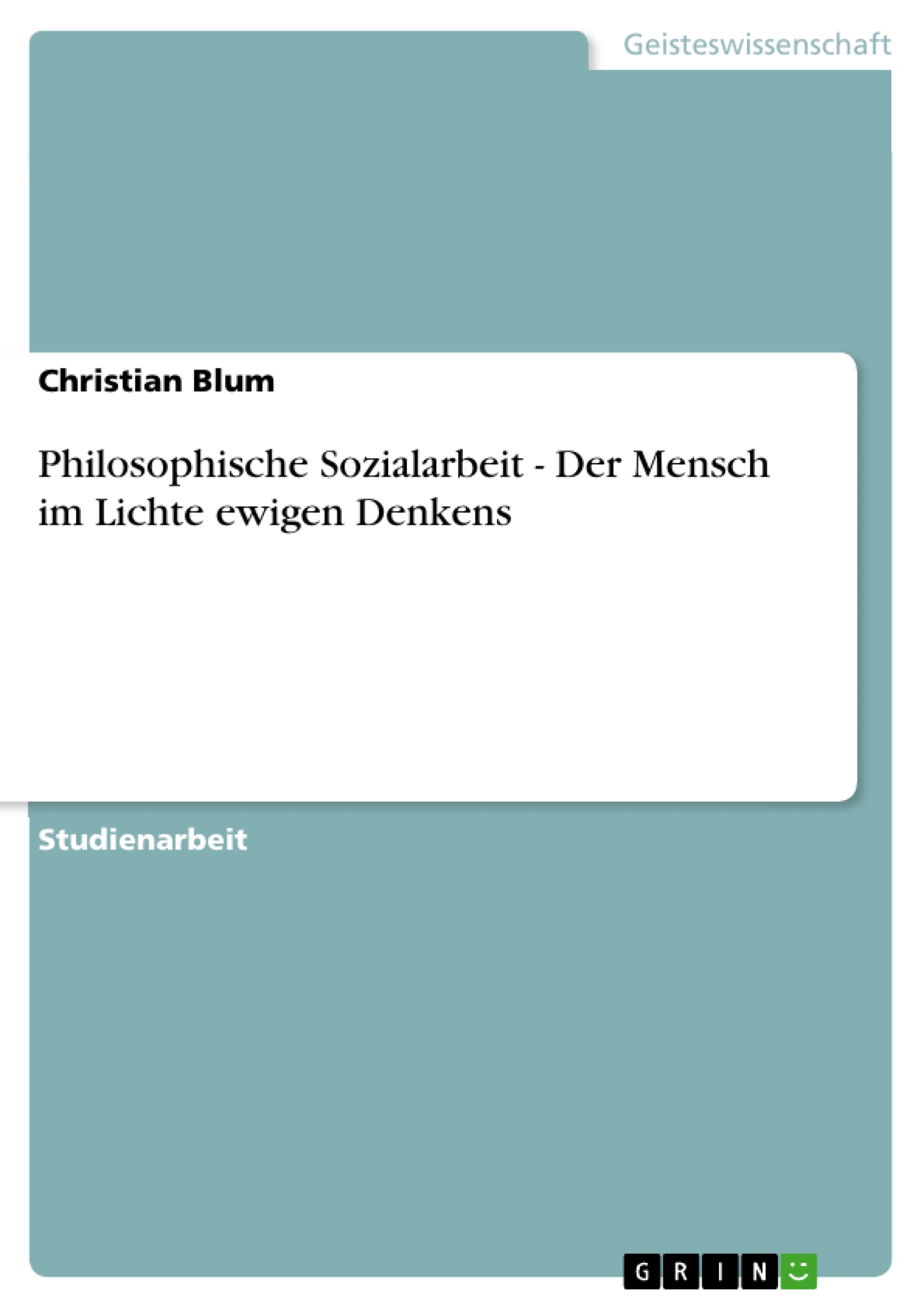In dieser Arbeit wird die Bedeutung der Philosophie für die professionelle Soziale Arbeit dargestellt. Wobei ethische, politische und methodische Implikationen von besonderer Bedeutung sind.
Inhalt
1 Einleitung
1.1 Zentrale Fragestellung
1.2 Methodische Vorgehensweise
2 Definitionen und Begriffe
2.1 Philosophie
2.2 Die philosophischen Grundbegriffe: „Sinn“ und „Glück“
2.3 Soziale Arbeit – Professionsbegriff
3 Philosophie und Soziale Arbeit
3.1 Spiritualität und ihre Bedeutung für die Soziale Arbeit
3.2 Warum als Sozialarbeiter philosophieren?
3.2.1 Die Frage nach dem Menschen
3.2.2 Ethische Intervention
3.2.3 Politische Haltung in der Sozialen Arbeit
4 Philosophische Methodologie
4.1 Das Konzept der „sokratischen Gesprächsführung“
4.2 Das Konzept der „lösungsorientierte Beratung“
4.3 Das Konzept der „philosophischen Praxis“
5 Schlussfolgerungen
6 Zusammenfassung
Quellenverzeichnis
Anhang
Eidesstattliche Erklärung