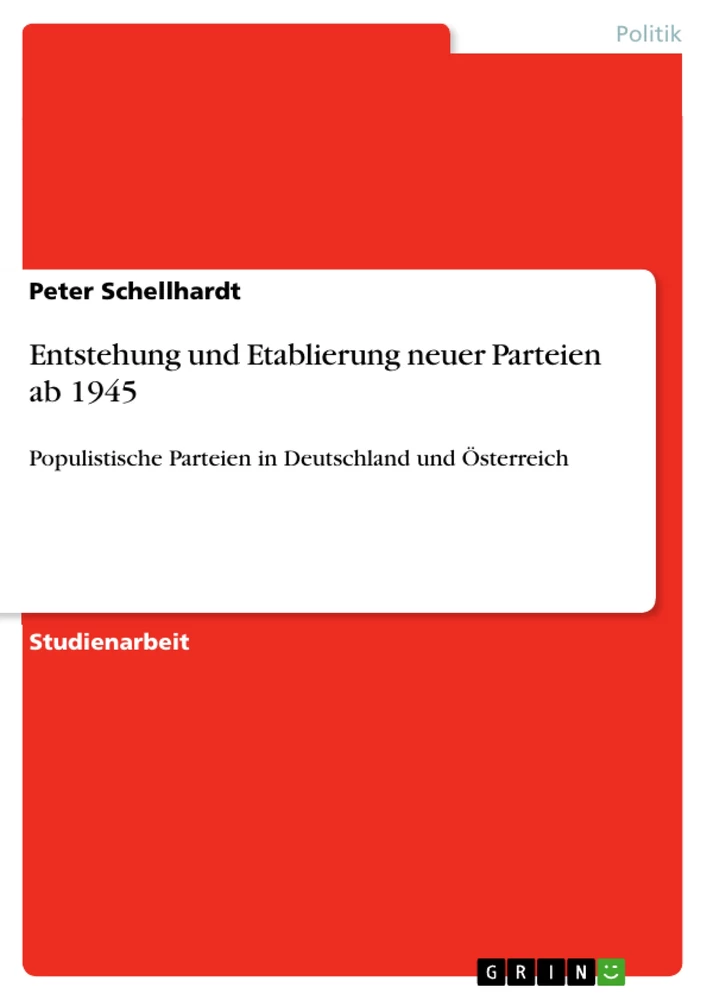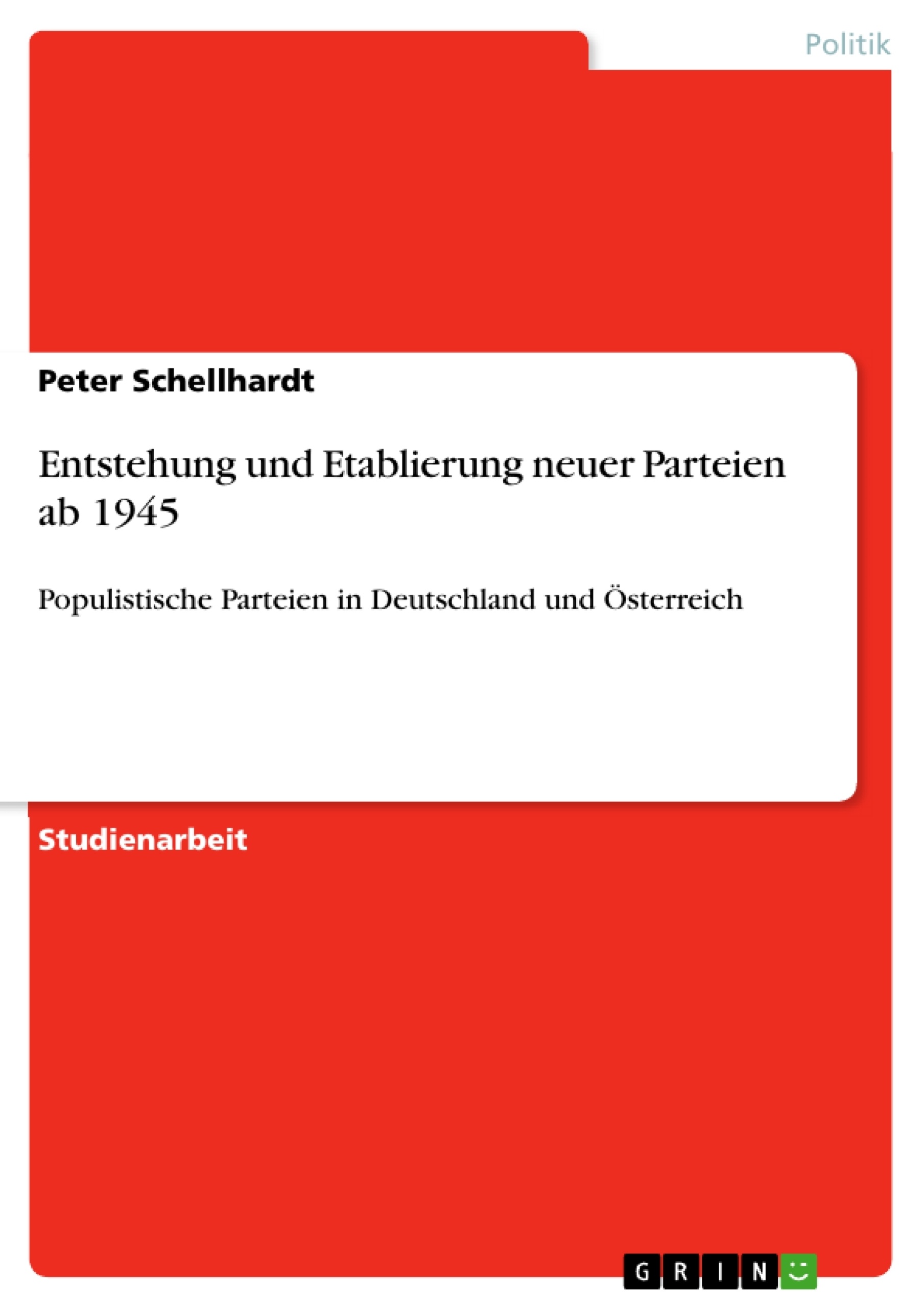Themengebiet 2 :
Vergleichende Untersuchung der Parteiensysteme westlicher Demokratien
Fokus B :
Entstehung und Etablierung neuer Parteien ab 1945
Thema :
Häufigere Große Koalitionen zwischen den Volksparteien führen zu einem Bedeutungsgewinn von rechtspopulistischen Parteien
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Definitionen, Begrifflichkeiten und theoretische Erklärungsansätze
2.1 Definitionen und Begrifflichkeiten
2.2 Theoretische Erklärungsansätze
2.1.1 Lipset/Rokkan : Parteien im Kontext mit gesellschaftlichen Konfliktlinien
2.1.2 Kirchheimer : Catch-All-Parties
3. Entwicklung der Parteiensysteme im Kontext von Regierungskoalitionen
3.1 Die Entwicklung des Parteiensystems in der Deutschland
3.2 Die Entwicklung des Parteiensystema in Österreich
4. Vergleich und Analyse der Parteisysteme
5. Warum sind rechtspopulistische Parteien in Deutschland nicht so erfolgreich
6. Schlussbemerkung
7. Literatur und Quellenverzeichnis
7.1 Literaturverzeichnis
7.2 Quellenverzeichnis