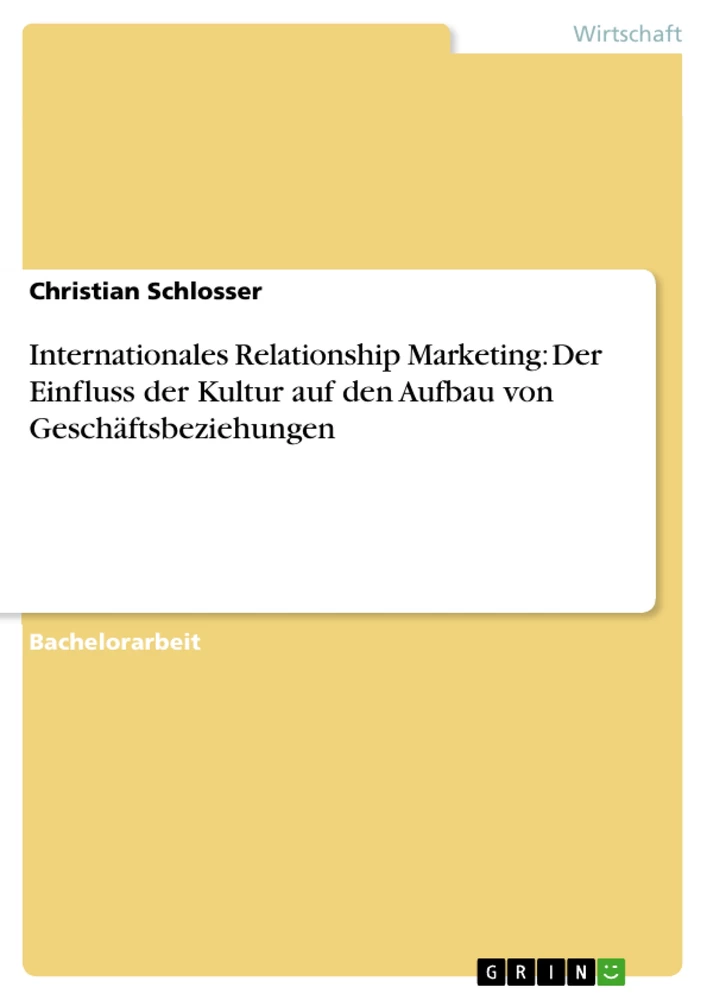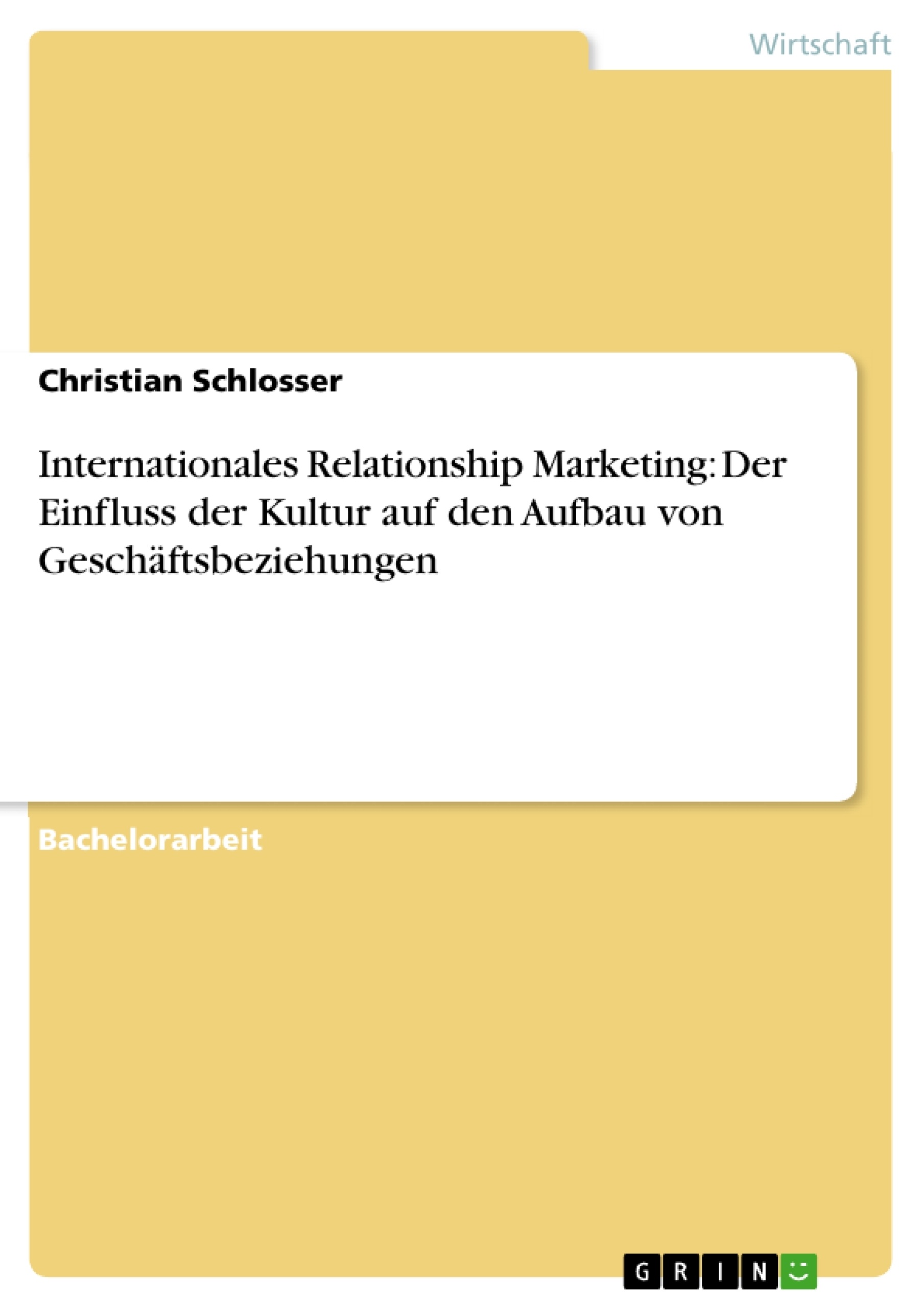Das Relationship Marketing wird seit den 1990er Jahren von vielen westlichen Marketingforschern als die Alternative zum traditionellen, transaktionsorientierten Ansatz des Marketing lanciert – zum Teil sogar als „Paradigmenwechsel“ betrachtet – und erlebt seitdem einen Aufschwung in der wissenschaftlichen Literatur.
Im Rahmen dieser Arbeit wird gezeigt, dass die Kultur ein wichtiger Einflussfaktor bei der Ausgestaltung von Geschäftsbeziehungen darstellt und der westliche Ansatz des Relationship Marketing nicht universell auf andere Ländermärkte anwendbar ist. Eine Geschäftsbeziehung kann in einem fremden Kulturkreis von unterschiedlichen Werten und Normen so geprägt sein, dass die Wirkungszusammenhänge der Beziehungszufriedenheit, dem Vertrauen, Commitment und der Beziehungsqualität in einer anderen Kausalität zueinander stehen. In Kulturen, die einen hohen Wert auf persönliche Beziehungen legen, kann sich die Implementierung einer Relationship Marketing-Strategie, die auf einem reinen Kosten-Nutzen-Kalkül basiert, als schwierig erweisen oder sogar scheitern. Um eine Geschäftsbeziehung in anderen Ländern erfolgreich auszugestalten, muss daher das Wertesystem dieser Landeskultur ausdrücklich mitberücksichtigt werden.
Inhaltsverzeichnis
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
TABELLENVERZEICHNIS
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
1. EINLEITUNG
2. THEORETISCHE FUNDIERUNG DES INTERNATIONALEN RELATIONSHIP MARKETING ...
2.1 Begriffsbestimmung des Relationship Marketing
2.2 Wesentliche Ziele und Konstrukte des Relationship Marketing
2.3 Herausforderungen an das Relationship Marketing im internationalen Kontext
3. BEDEUTUNG DER KULTUR AUS WISSENSCHAFTLICH-ANTHROPOLOGISCHER SICHT
3.1 Der Kulturbegriff und seine Elemente
3.2 Zentrale Studien zu den Dimensionen einer Kultur - ein Überblick
3.2.1 Die Kulturdimensionen von Hall
3.2.2 Die Kulturdimensionen von Trompenaars
3.2.3 Die Kulturdimensionen von Hofstede
4. KULTURVERGLEICHENDE ANALYSE
4.1 Vergleich westlicher und asiatischer Kulturdimensionen als Basis der Analyse
4.1.1 Identifikation einer geeigneten Kulturstudie
4.1.2 Vergleich der Kulturdimensionen Hofstedes am Beispiel der USA und China
4.2 Der Einfluss relevanter Kulturdimensionen Hofstedes bei der Ausgestaltung von Geschäftsbeziehungen in den USA und China
4.2.1 Einfluss der Dimension „Langzeit- versus Kurzzeitorientierung“
4.2.2 Einfluss der Dimension „Individualismus versus Kollektivismus“
4.2.3 Einfluss der Dimension „Machtdistanz“
4.3 Schlussbetrachtung und Implikationen für das Management
5. FAZIT
ANHANG
LITERATURVERZEICHNIS