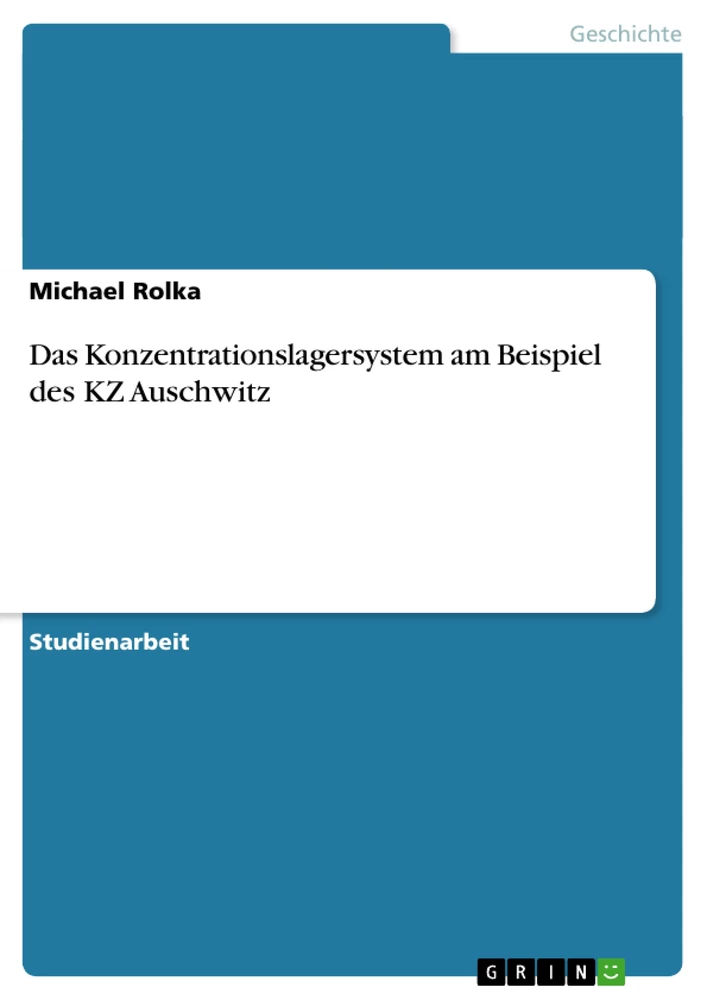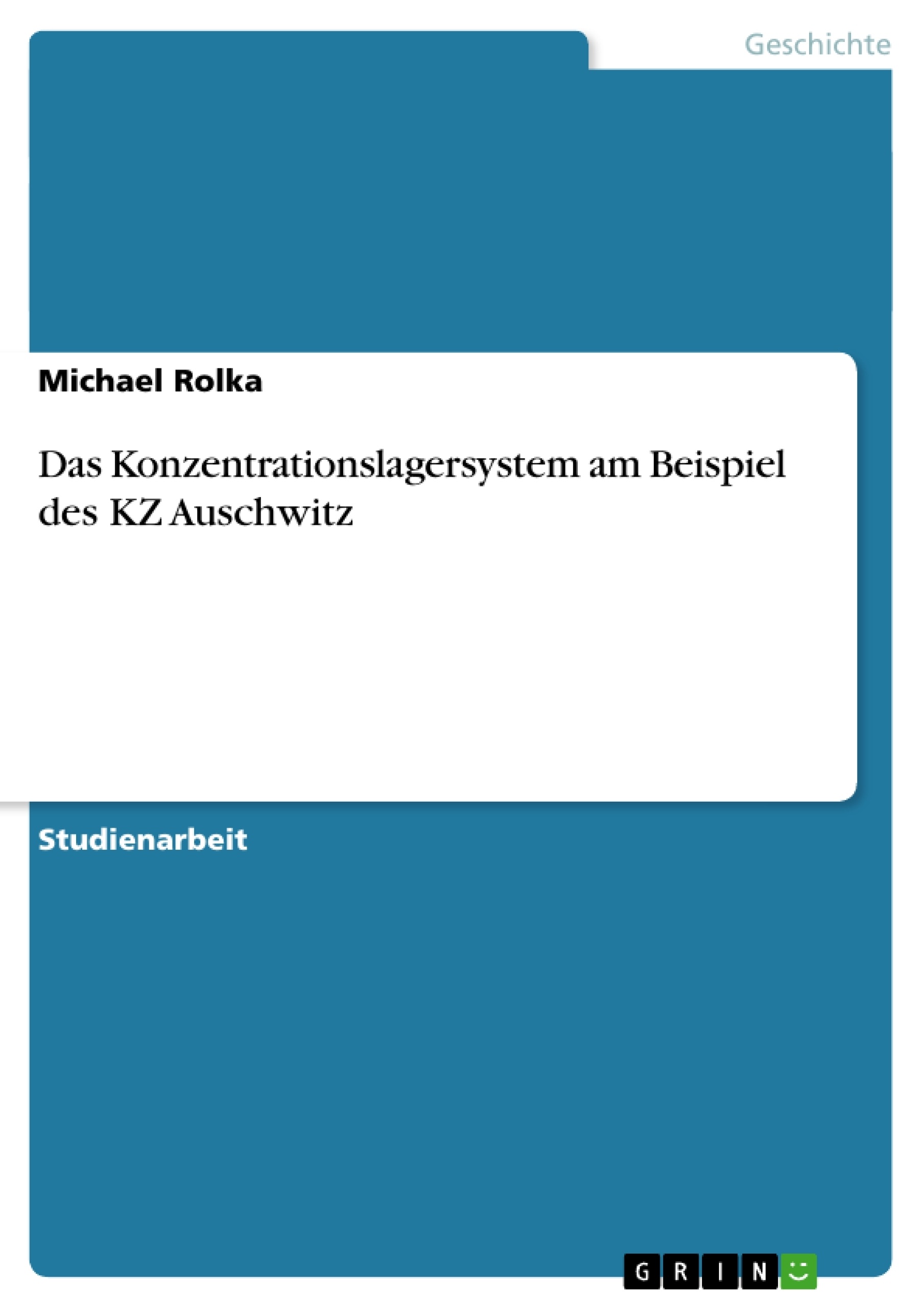Das Konzentrationslager Auschwitz war das letzte Konzentrationslager, dass geschlossen, bzw. von den Alliierten befreit wurde. Auschwitz steht für tausendfaches Leid und wurde zum Synonym für den Holocaust. Ich möchte den Wandel des Konzentrationslagers Auschwitz von einem „normalen“ Konzentrationslager, hin zum zentralen Instrument der „Endlösung“ aufzeigen. Dabei stellt sich die Frage, ob diese Entwicklung für Auschwitz absehbar war? War diese Entscheidung rein zufällig oder gab es Gründe, die für die Wahl von Auschwitz sprachen? Im ersten Teil meines Referates möchte ich kurz auf die Geschichte der Konzentrationslager eingehen, bevor ich auf das eigentliche Thema zu sprechen komme. In einem dritten Teil möchte ich das Leben im KZ und die dort von der SS etablierten Machtstrukturen kurz beschreiben.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Konzentrationslager in Deutschland
Das Konzentrationslager Auschwitz
Das Leben im KZ Auschwitz
Fazit
Literaturverzeichnis
Bibliographie zum Thema Auschwitz / Konzentrationslager
Einleitung
Das Konzentrationslager Auschwitz war das letzte Konzentrationslager, dass geschlossen, bzw. von den Alliierten befreit wurde. Auschwitz steht für tausendfaches Leid und wurde zum Synonym für den Holocaust.
Ich möchte den Wandel des Konzentrationslagers Auschwitz von einem „normalen“ Konzentrationslager, hin zum zentralen Instrument der „Endlösung“ aufzeigen. Dabei stellt sich die Frage, ob diese Entwicklung für Auschwitz absehbar war? War diese Entscheidung rein zufällig oder gab es Gründe, die für die Wahl von Auschwitz sprachen?
Im ersten Teil meines Referates möchte ich kurz auf die Geschichte der Konzentrationslager eingehen, bevor ich auf das eigentliche Thema zu sprechen komme. In einem dritten Teil möchte ich das Leben im KZ und die dort von der SS etablierten Machtstrukturen kurz beschreiben.
Konzentrationslager in Deutschland
Die Nazis wiesen gerne darauf hin, dass Konzentrationslager nicht ihre Erfindung seien. Und damit hatten sie sogar recht. Die rechtlichen Grundlagen für die Einrichtung solcher Konzentrationslager wurden bereits am 24.09.1848 durch das „preußische Gesetz zum Schutz der persönlichen Freiheit“ geschaffen. Mit diesem Gesetz war die Haft „zum Schutz der eigenen Person“ eingeführt worden. Durch das „Preußische Gesetz über den Belagerungszustand“ vom 04.06.1851 wurde dieser Haftgrund weiter ausgebaut[1]. Das Belagerungszustandsgesetz ermöglichte es dem Militär, nach Verhängung des Belagerungszustandes, Personen unbefristet und ohne jegliche richterliche Kontrolle in „militärische Sicherungshaft“ zu überführen[2].
Diese Gesetze hatten bis zum 11.08.1919 bestand. An diesem Tag wurden sie aber nicht abgeschafft, sondern lediglich durch den Artikel 48, Abs. 2 der Weimarer Reichsverfassung ersetzt. Der „Belagerungszustand“ wurde zum „Ausnahmezustand“[3]. Von diesem Artikel wurde oft Gebrauch gemacht. Nach der wiederholten Verhängung des Ausnahmezustandes durch den Reichspräsidenten im September 1923 stieg die Zahl der nunmehr als „Schutzhäftlinge“ bezeichneten so stark an, dass Gefängnisse nicht mehr ausreichten und ehemalige Kriegsgefangenenlager und Truppenübungsplätze zu den ersten deutschen Konzentrationslagern umfunktioniert werden mussten[4].
Die Nazis konnten nach der Machtübernahme also auf einen recht großen Erfahrungswert hinsichtlich der Konzentrationslager zurückgreifen. Anfang März 1933 wurde im thüringischen Nohra das erste KZ des Regimes eingerichtet[5]. Dies bestand allerdings nur bis Juli 1933. Dieses und ähnliche Lager wurden als Sammellager bezeichnet und waren in der Regel nur zeitlich befristete Einrichtungen[6]. Das erste „echte“ Konzentrationslager, wie wir es verstehen, war das KZ Sachsenhausen. Es entstand Mitte 1936[7].
Das Konzentrationslager Auschwitz
Das Konzentrationslager Auschwitz wurde erst sehr spät gegründet. Es entstand im Mai 1940[8]. Das KZ Auschwitz war ursprünglich als Lager für Personen gedacht, denen man, im Sinne der Nazis, nur „leichte und korrigierbare Vergehen vorwarf“[9].
Für die Wahl des Standortes Auschwitz für ein neues KZ gab es mehrere Gründe. Himmler war als Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums auch verantwortlich „[...] for transforming the ideology of resettlement into practical policy [...]“[10]. Er wollte die Stadt Auschwitz zum Mittelpunkt der deutschen Siedlungspolitik im neuen deutschen Osten machen. Die Stadt Auschwitz sollte zu einer „District Capital“ ausgebaut werden. In diesem Zusammenhang waren im großen Stil Industrieansiedlung für Auschwitz geplant[11]. Um das Stammlager Auschwitz I und das Lager Auschwitz II – Birkenau entstanden zwischen 1942 und 1944 rund 50 Außenlager[12]. Diese reinen Zwangsarbeiterlager dienten der dort ansässigen Industrie zur Versorgung mit Zwangsarbeitern (unter anderem die IG Farben, Deutsche Erd- und Steinwerke (DEst), Herman –Göring – Werke, um nur einige der größten zu nennen) und der Ausbeutung der vorhandenen Bodenschätze. Das erste und wahrscheinlich bekannteste dieser Außenlager war das sogenannte Buna – Lager der Buna Werke (IG Farben), welches später in Auschwitz III – Monowitz umbenannt wurde[13]. Mindestens 28 dieser Außenlager arbeiteten direkt oder indirekt für die Rüstungsindustrie[14]
Im März 1941 wurde mit Hinblick auf den Russlandfeldzug der Bau des Lagers Auschwitz II, besser bekannt unter dem Namen Auschwitz – Birkenau, beschlossen.[15]. Das Lager Birkenau war als reines Kriegsgefangenenlager konzipiert und sollte nur eine vorrübergehende Einrichtung darstellen[16]. Die Kriegsgefangenen sollten als Zwangsarbeiter den Plänen Himmlers dienen[17]. Am 25.09.1941 wurde die Übergabe von 100.000 russischen Kriegsgefangenen durch die Wehrmacht an die SS beschlossen. Als die ersten 10.000 Sowjets in Auschwitz eintrafen war noch kein Lager für diese Kriegsgefangenen vorhanden. Sie mussten sich ihre Unterkünfte selber bauen[18].
Bis zu diesem Zeitpunkt unterschied sich Auschwitz nicht sonderlich von anderen Konzentrationslagern. Ein Wendepunkt in der Geschichte von Auschwitz stellt der September 1941 dar. In diesem Monat wurden zum ersten mal Menschen vergast. 850 Menschen, 200 kranke und 650 sowjetische Kriegsgefangene, waren die ersten Opfer dieser neuen Form des Massenmordes[19]. Diese ersten Vergasungen waren nur ein Experiment, das auf die Initiative des Stellvertretenden Lagerkommandanten Karl Fritsch zurückging. Die „Endlösung“ war dabei noch nicht im Blick der Verantwortlichen. Lediglich Lagerkommandant Rudolf Höss erkannte in der neuen Form des Massenmordes die „Antwort auf die Judenfrage“[20].
Diese neue und wesentlich effektivere Methode des Massenmordes stellte die Lagerkommandantur aber vor neue Probleme. Wohin mit den Toten? Massengräber wären Anfangs zwar eine Möglichkeit gewesen, aber spätestens seit der Wannseekonferenz vom 20.01.1942 mussten neue Kapazitäten hinsichtlich Vergasung und vor allem hinsichtlich der Beseitigung der Toten geschaffen werden[21]. Man entschied sich schließlich, die Toten einfach zu verbrennen. Allerdings reichte das in Auschwitz existierende Krematorium I dafür nicht aus. Die Firma Topf und Sohn wurde mit dem Bau weiterer Krematorien für Auschwitz beauftragt[22]. Bis Juni 1943 gab es dann insgesamt fünf Krematorien in Auschwitz. Vier standen in Birkenau und eines stand im Stammlager Auschwitz I. Seit diesem Zeitpunkt war man in der Lage binnen 24 Stunden 4736 Tote zu verbrennen. Das entspricht weit über einer Million Menschen pro Jahr, die auf diese Weise vernichtet werden konnten[23].
[...]
[1] Preußische Gesetzessammlung, 1848, S. 257 und 1851, S. 451f, zitiert nach: Drobisch, Klaus und Wieland, Günther: System der NS – Konzentrationslager 1933 – 1939, Berlin 1993, S. 16.
[2] Drobisch, Klaus, Wieland, Günther: System der NS – Konzentrationslager 1933 – 1939, Berlin 1993, S. 16. (im folgenden zitiert als „Drobisch / Wieland“)
[3] Drobisch / Wieland, S. 18.
[4] Drobisch / Wieland, S 18.
[5] Drobisch / Wieland, S. 11.
[6] Drobisch / Wieland, S. 11f.
[7] Drobisch / Wieland, S 262ff.
[8] Gutman, Yisrael: Auschwitz – An Overview, in: Gutman, Berenbaum (Hrsg,) : Anatomy of the Auschwitz Death Camp, New York 1994, S. 6. (Im folgenden zitiert als „Gutman“ und „Gutman / Berenbaum“)
[9] Gutman, in: Gutman / Berenbaum, S. 6.
[10] Van Pelt, Robert – Jan: A site in Search of a Mission, in: Gutman, Berenbaum, S 99. (Im folgenden zitiert als “van Pelt“)
[11] van Pelt, in: Gutman / Berenbaum S. 94.
[12] Krakowski, Shmuel: The Satellite Camps, in: Gutman / Berenbaum, S. 50. (Im folgenden zitiert als „Krakowski“)
[13] Krakowski, in: Gutman / Berenbaum, S.52.
[14] Czech, Danuta: KL Auschwitz: An Historical Outline, Warschau 1987, S. 30f, zitiert nach: Gutman, in: Gutman / Berenbaum, S 18.
[15] van Pelt, in: Gutman / Berenbaum S. 114.
[16] van Pelt, in: Gutman / Berenbaum S. 139.
[17] van Pelt, in: Gutman / Berenbaum S. 114.
[18] van Pelt, in: Gutman / Berenbaum S. 118.
[19] Krakowski, in: Gutman / Berenbaum, S. 84.
[20] Krakowski, in: Gutman / Berenbaum, S. 84.
[21] Hilberg, Raul: Auschwitz and the Final Solution, in: Gutman / Berenbaum, S. 85f. (Im folgenden zitiert als „Hilberg“)
[22] van Pelt, in: Gutman / Berenbaum S. 139.
[23] Hilberg, in: Gutman / Berenbaum, S. 87f.