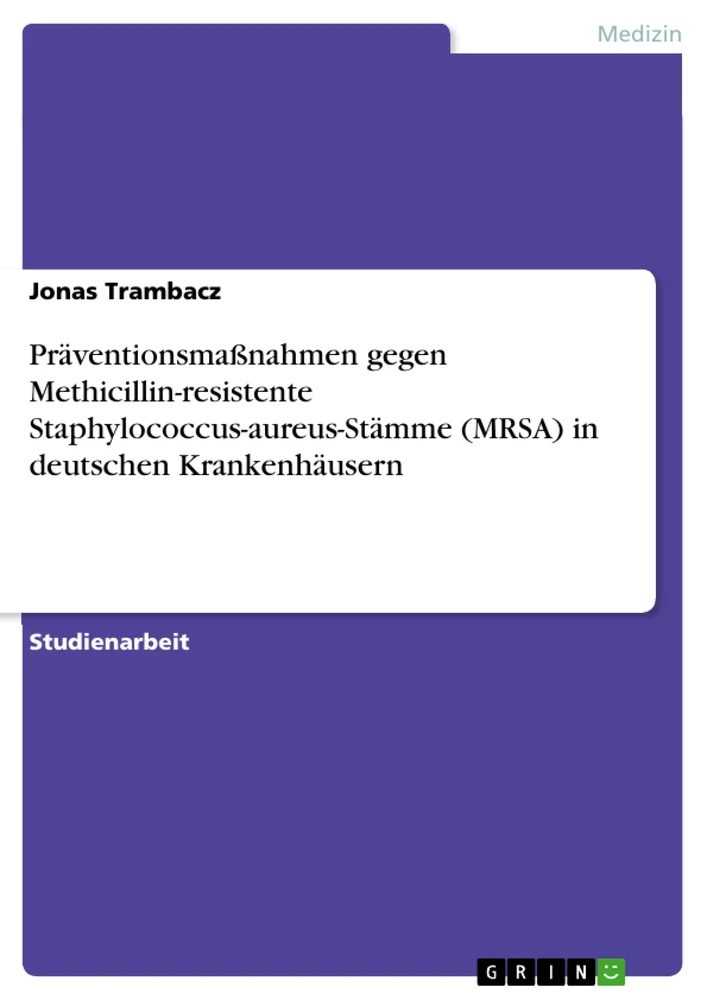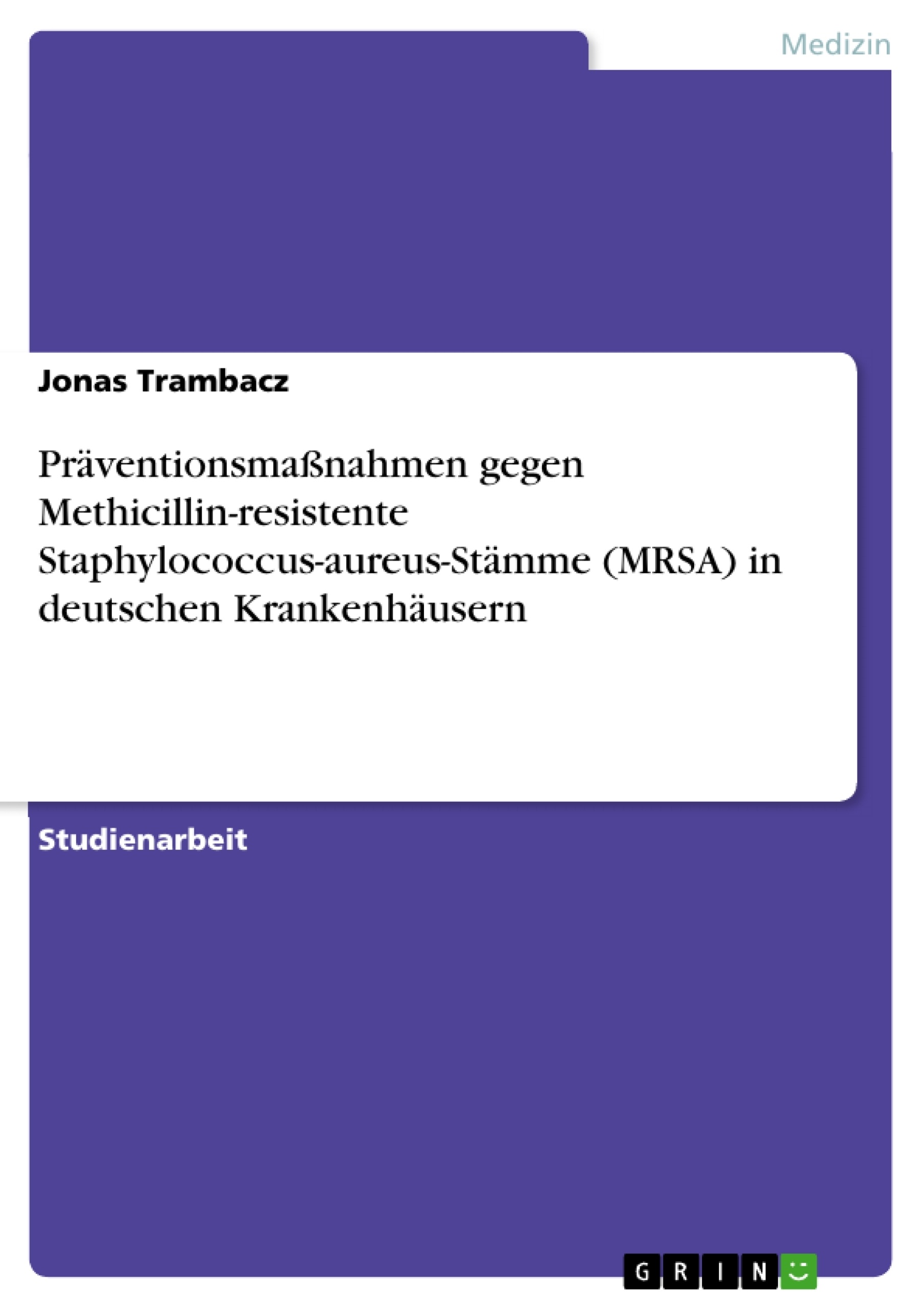Bei Methicillin-resistenten Staphylococcus-aureus-Stämmen handelt es sich um ein Bakterienstamm, welcher ein nationales Problem in den Krankenhäusern darstellt. MRSA-Patienten verursachen höhere Kosten für das Krankenhaus und somit über die Krankenhausfinanzierung (DRG) für die ganze Gesellschaft. Des Weiteren bedürfen MRSA-besiedelte Patienten intensiverer pflegerischer sowie medizinischer Versorgung und bedeuten für das Krankenhaus erheblichen organisatorischen Aufwand.
Aus diesen Gründen sollten die Empfehlungen zur Bekämpfung von MRSA, beispielsweise von der KRINKO korrekt umgesetzt werden. Ganz allgemein sind es:
- Kontrollierte Antibiotikagabe - Prävention
- Surveillance
- Therapie und Sanierung
- Aufklärung
Die Hausarbeit zeigt, dass diese Empfehlungen weitgehend umgesetzt werden, jedoch bei einzelnen Elementen Verbesserungsbedarf besteht. Es sollte also Aufgabe der Klinikleitung, respektive des Qualitätmanagements in Kooperation mit der Krankenhaushygiene sein, eine effizientere Umsetzung der Präventionsmaßnahmen zu kommunizieren. Fortbildungen sollten angeboten und regelmäßige Mitarbeiterscreenings durchgeführt werden. Ein striktes Eingangsscreening sollte obligatorisch koordiniert werden. Eben- falls muss das Thema MRSA mit den Angehörigen, beziehungsweise Besuchern ausreichend besprochen werden.
Werden diese Empfehlungen in den kommenden Jahren umgesetzt, sollte es deutschen Krankenhäusern möglich sein, MRSA-Infektionen zu verringern, beziehungsweise zu vermeiden.
Inhaltsverzeichnis
II. Abbildungsverzeichnis
III. Tabellenverzeichnis
IV. Abkürzungsverzeichnis
1. Einleitung
2. Begriffserläuterungen
2.1 Prävention
2.2 Stationärer Bereich
3. MRSA
3.1 Definition
3.2 Prävalenz
3.3 Diagnose
3.4 Übertragungswege
3.5 Risikopatienten
3.6 Symptome
3.7 Medikamentöse Therapie
3.8 Meldepflicht
4. Hygienemaßnahmen zur Bekämpfung von MRSA
4.1 Isolierung
4.2 Maßnahmen zum Schutz vor Kontamination
4.3 Sanierung
4.4 Desinfektion und Reinigung
5. Kosten
6. Präventionsmaßnahmen von MRSA
7. Umsetzung der Präventionsmaßnahmen in deutschen Krankenhäusern
8. Fazit
V. Literaturverzeichnis
VI. Eidesstattliche Erklärung