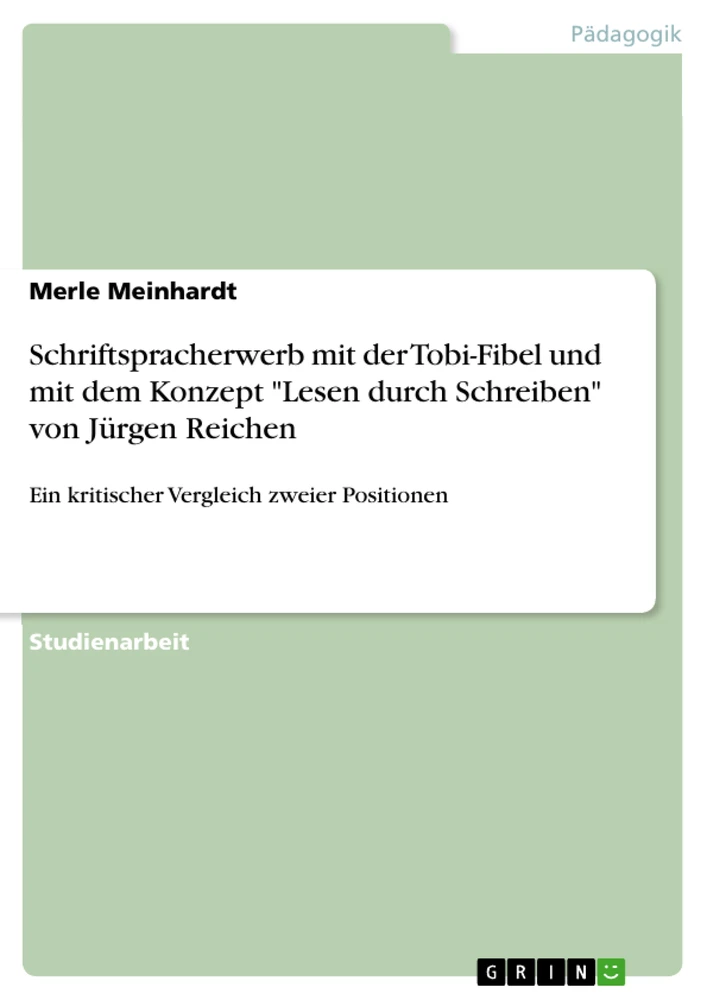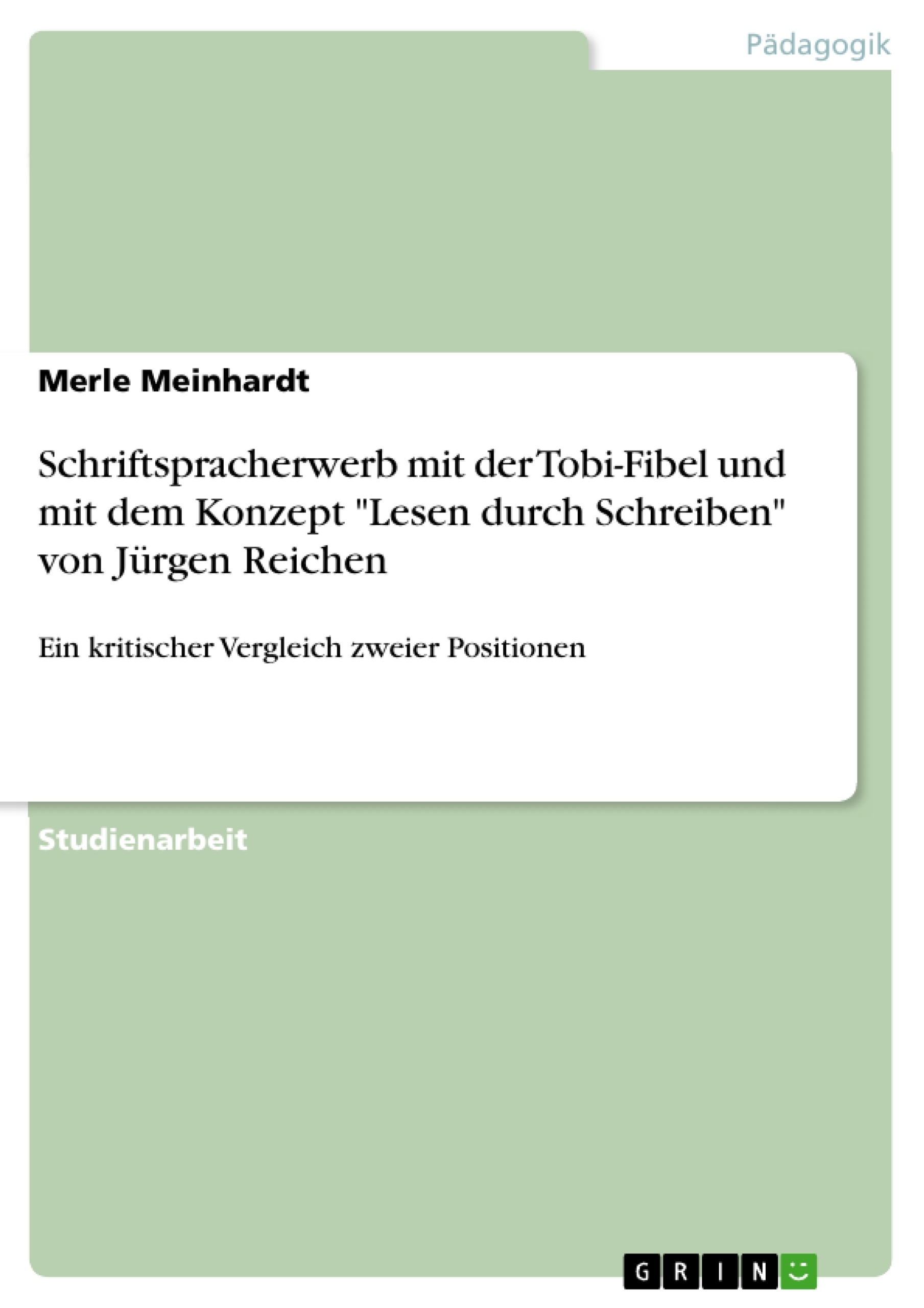Die Fähigkeit lesen zu können, ist in unserer Gesellschaft von grundlegender Bedeutung, da jeglicher Bildungserfolg von ihr abhängt.
Deshalb wird diese Kulturtechnik unmittelbar zu Beginn des Bildungsweges – schwerpunktmäßig im ersten Schuljahr – gelehrt.
Für die Vermittlung des Lesens stehen den Lehrkräften heutzutage eine Vielzahl methodischer Konzepte zur Verfügung.
Dem traditionellen Leselehrgang mit einer Fibel wird dabei seit einigen Jahren u. a. durch das Konzept „Lesen durch Schreiben“ Konkurrenz geboten.
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es deshalb, die beiden unterschiedlichen Konzepte auf ihr methodisches Vorgehen bezüglich des Lesenlernens hin zu analysieren und einen kritischen Vergleich zu ziehen.
Eine Bewertung beider Konzepte soll im Anschluss auf Basis des Stufenmodells der Entwicklung des Wortlesens, welches von Gerheid Scheerer- Neumann entwickelt wurde und den Lernprozess des Lesens darstellt, erfolgen.
Da es heutzutage zahlreiche unterschiedlich aufgebaute Fibeln gibt, die im Anfangsunterricht zum Einsatz kommen, wird sich in dieser Arbeit auf den Tobi- Fibellehrgang beschränkt, welcher insbesondere in den norddeutschen Bundesländern häufig zum Einsatz kommt.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Das lesedidaktische Konzept des Tobi- Fibellehrgangs
3 Das Konzept Lesen durch Schreiben von Jürgen Reichen
4 Das Stufenmodell der Entwicklung des Wortlesens nach Scheerer- Neumann
5 Fazit
6 Literaturverzeichnis