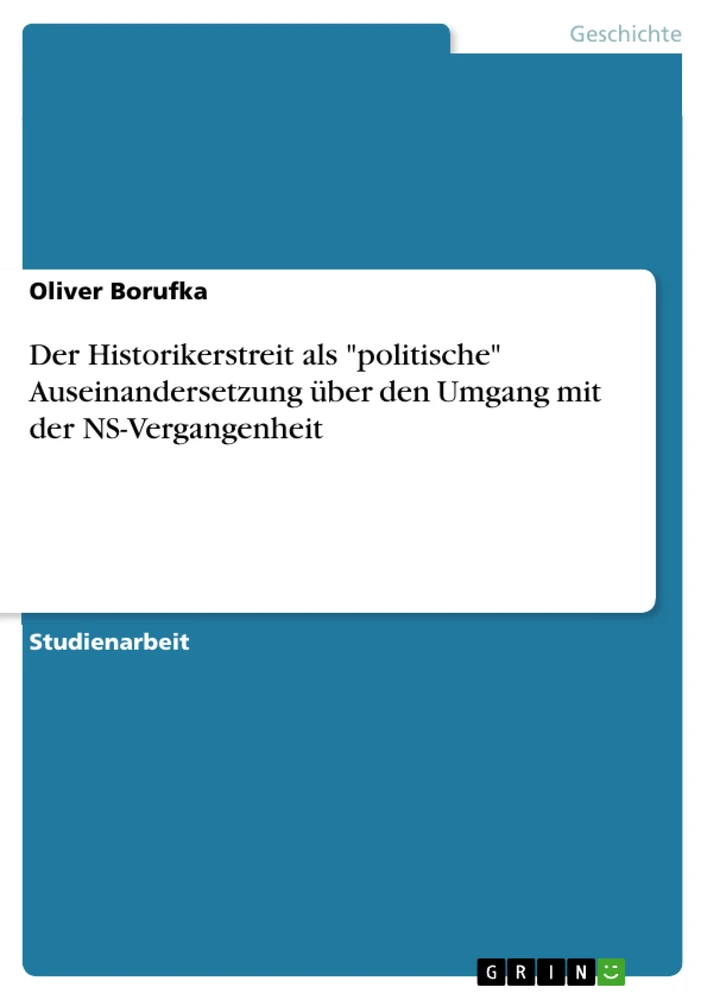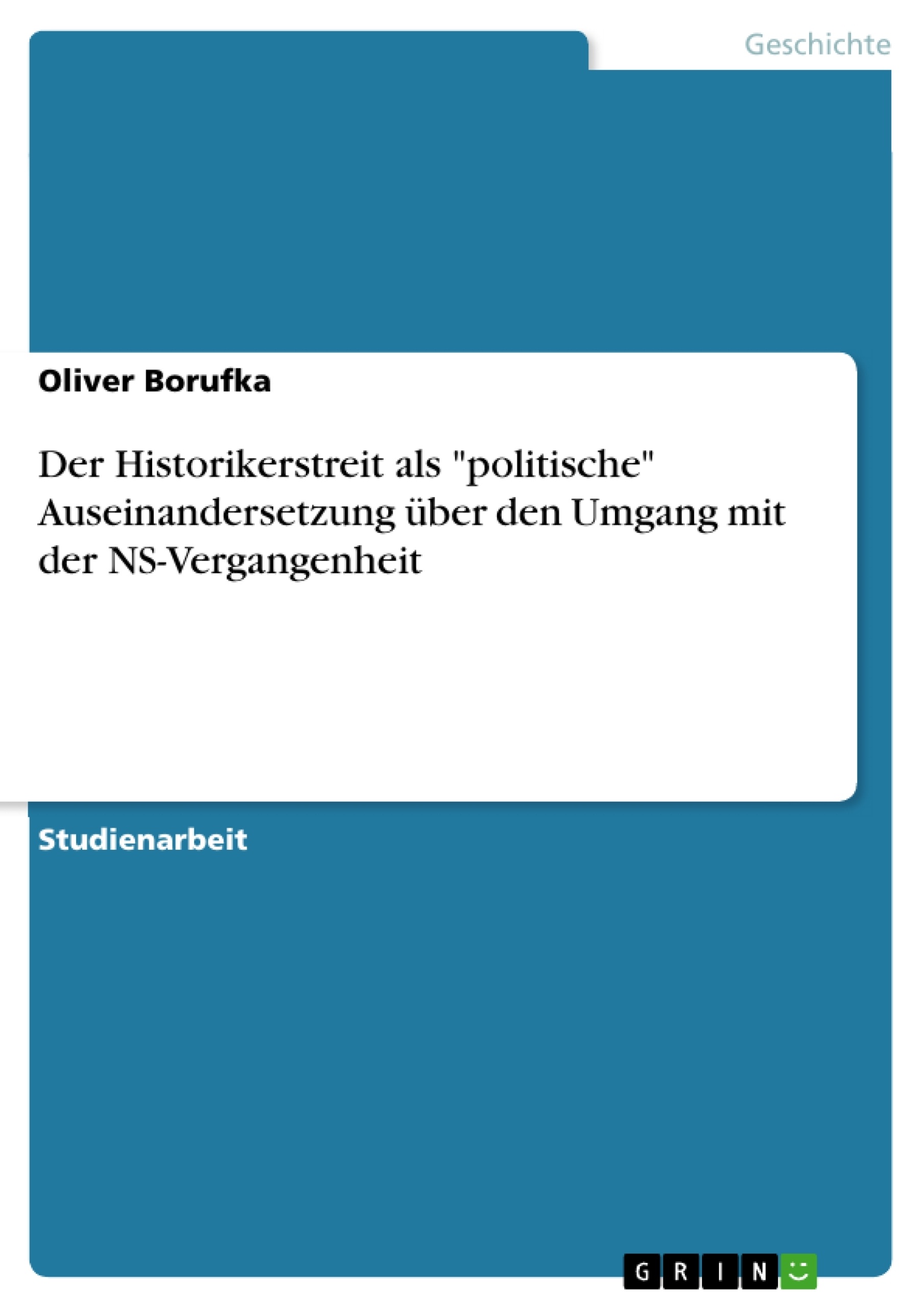Das Jahr 1982 markierte einen erneuten Wendepunkt in der Geschichte der Bundesrepublik. Die seit dreizehn Jahren regierende Koalition aus SPD und FDP wurde durch das christlich-liberale Kabinett Helmut Kohls verdrängt. Mit dem Wechsel der Regierung ging nicht nur ein politischer, sondern ebenso ein geistiger Umbruch einher. Das zeigte sich unter anderem außenpolitisch in den Bemühungen, durch demonstrative Gesten der Aussöhnung (vgl. Kapitel 3) die Westbindung der alten Bundesrepublik wieder stärker zu betonen, und innenpolitisch an den Anstrengungen, positiv auf das Geschichtsbild der Deutschen einzuwirken, mit dem letztendlichen Ziel der Stärkung des Identitätsgefühls. Von diesen Bestrebungen ermutigt, begannen auch konservative Intellektuelle wieder die Initiative zu ergreifen. Diese Entwicklung wurde von linksliberaler Seite zunehmend kritisch, gar ängstlich verfolgt, schien doch eine „Tendenzwende“, durch die viele geistige Errungenschaften der siebziger Jahre rückgängig gemacht werden sollten, Realität zu werden. Den Höhepunkt dieser Gegnerschaft stellte schließlich 1986 der sogenannte „Historikerstreit“ dar, in dem sich die lange gepflegten Ressentiments linksliberaler und konservativer Intellektueller entluden.
Inhaltverzeichnis
1. Einleitung
2. Der gesellschaftliche Umgang mit der NS-Vergangenheit in der BRD der achtziger Jahre
3. Die Geschichtspolitik der Regierung Kohl
4. Der Historikerstreit als „politische“ Auseinandersetzung
5. Fazit
6. Quellen- und Literaturverzeichnis