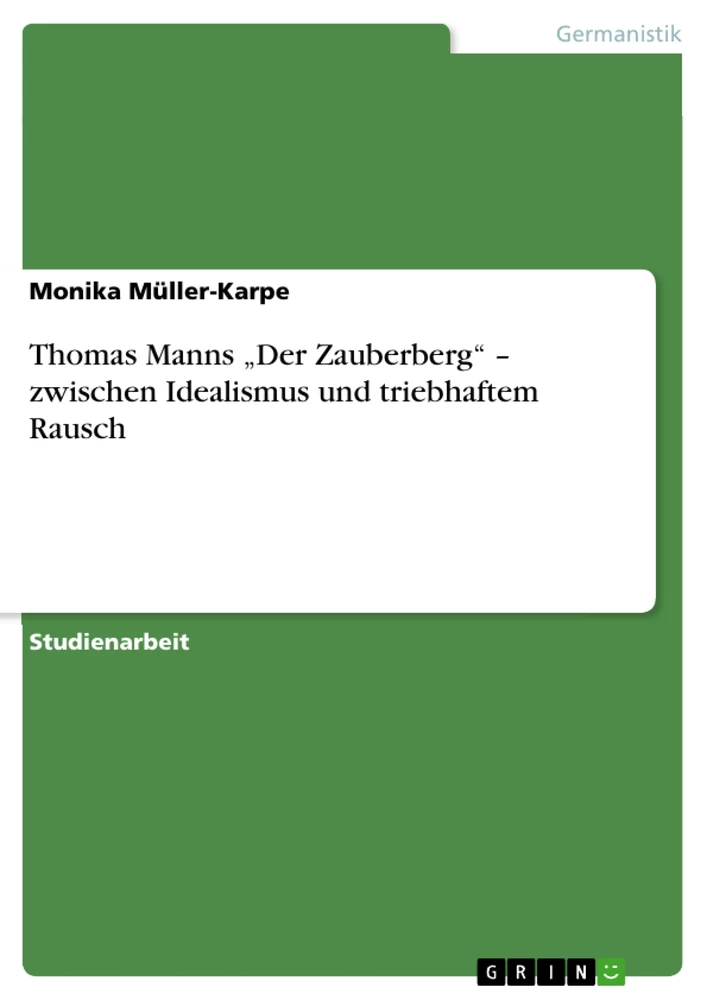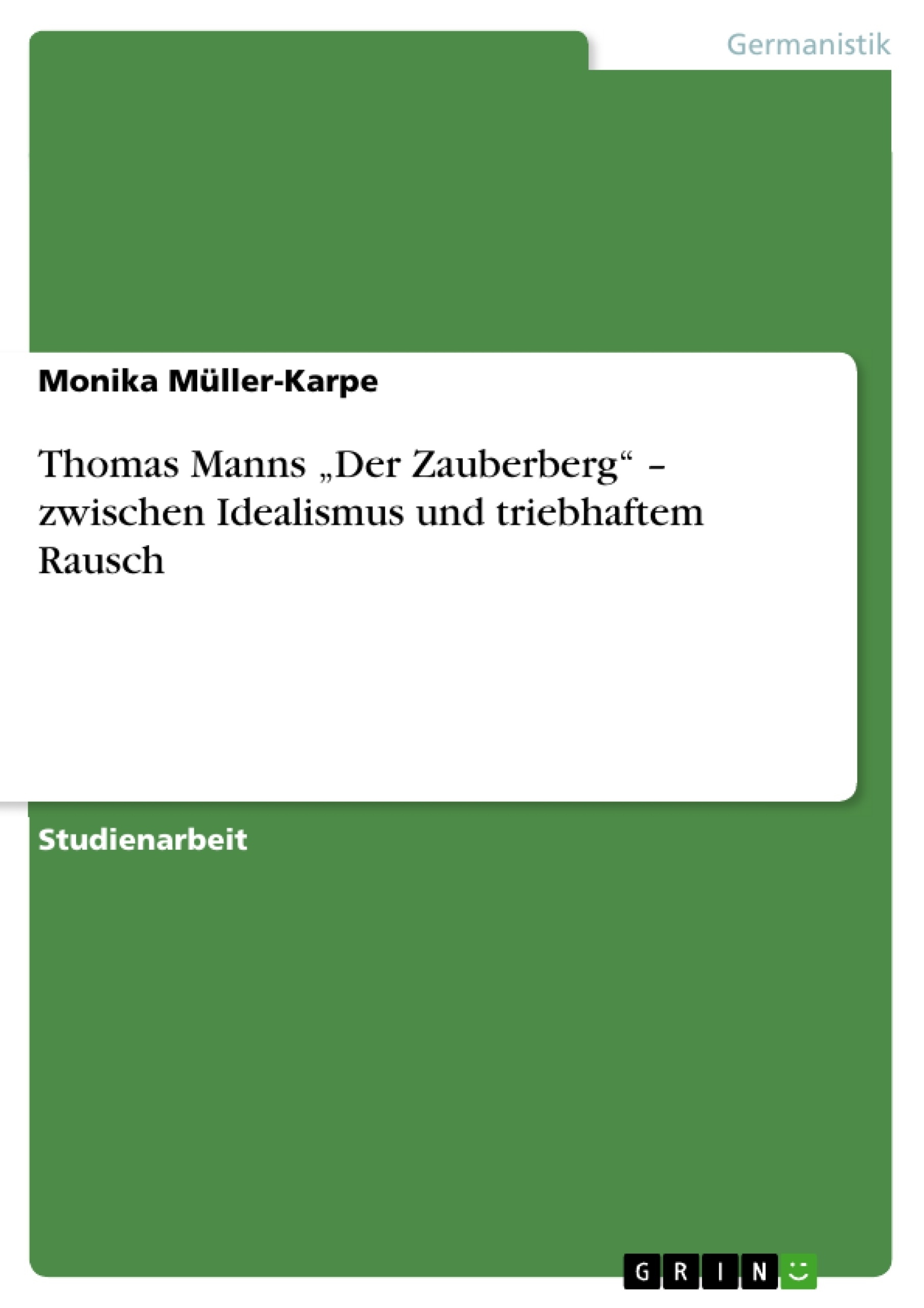Bereits in Thomas Manns Novelle „Der Tod in Venedig“ zeichnet sich beim Protagonisten Gustav Aschenbach der Konflikt zwischen strengem Idealismus und rauschhafter Hingabe an die niederen Triebe ab. In seinem Roman „Der Zauberberg“ kontrastiert Thomas Mann diese Gegensätze nicht nur explizit durch bestimmte Begriffe und Personen, sondern spielt mit ihren auf den ersten Blick eindeutig erscheinenden Grenzen. Im Folgenden soll zunächst, anhand der Untersuchung der Stimmung auf dem Zauberberg insgesamt, der Analyse polarisierender Persönlichkeiten sowie der Betrachtung der Darstellung der Krankheit, herausgearbeitet werden, auf welche Weise Thomas Mann die zwei verschiedenen Positionen darstellt und welcher Mittel er sich dabei bedient. Anschließend soll, unter anderem in Bezugnahme auf die Schneeszene und den Schluss des Buches, Lotti Sandts Aussage diskutiert werden, der Schluss des Zauberbergs sei versöhnlich und lebensfreundlich. Findet Castorp den Weg aus der Platonischen Höhle zu wahrer Erkenntnis oder gibt er sich letztlich doch der sinnlichen Macht der animalischen Instinkte des Menschen hin? Welcher Ort ist hier die Höhle, der Zauberberg selbst oder das Flachland? Wie kann die von Thomas Mann beschriebene „Steigerung“ des Hans Castorp verstanden werden?
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Zauberberg- Atmosphäre
2.1. Veränderung des Zeitbegriffs
2.2. Umgang und Bedeutung des Todes
2.3. Stimmung und Verhalten der Patienten
3. Personalisierung des geistigen Konflikts und die Verkörperung des Schwebezustandes zwischen den konkurrierenden Polen
3.1. Settembrini und Joachim -Vertreter der idealistischen Strenge Naphta
3.2. Naphta und Clawdia Chauchat - Vertreter des Rausches und der Sinnlichkeit
3.3. Peeperkorn -die Vereinigung der Gegensätze
4. Thomas Manns Verhältnis zur Psychoanalyse
4.1. Bewunderung und Misstrauen
4.2. Krokowski
4.3. Krankheit als Erhöhung des Geistes?
5. Deutung der Schneeszene, Bedeutung der Ironie im Zauberberg und Diskussion des Schlusses
5.1. Deutung der Schneeszene
5.2. Bedeutung der Ironie im Zauberberg
5.3. Diskussion des Schlusses
6. Fazit