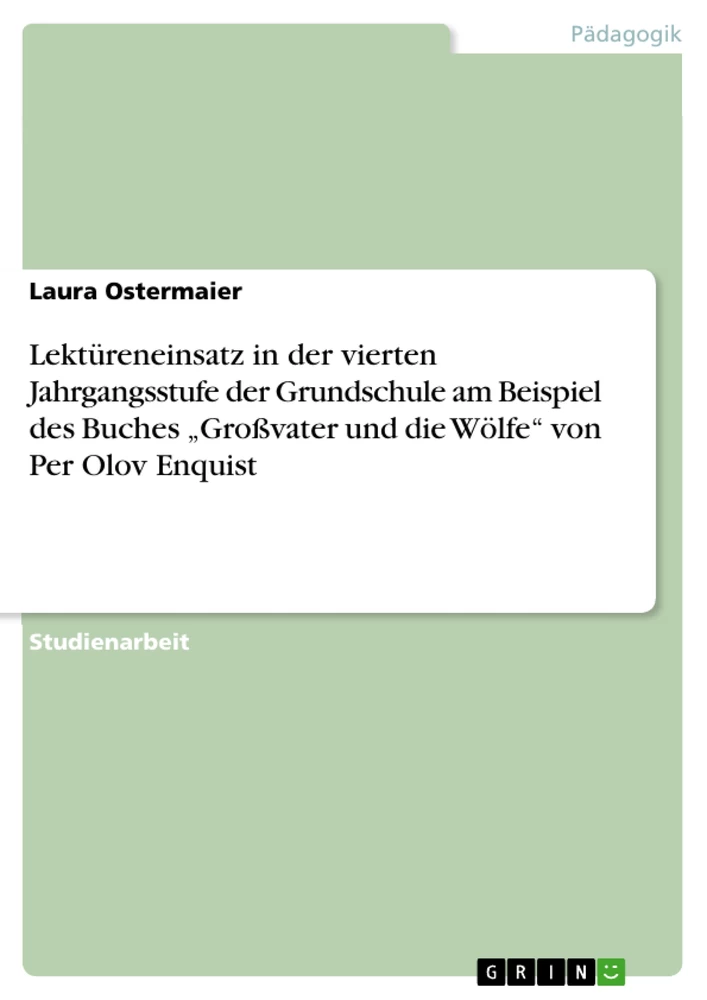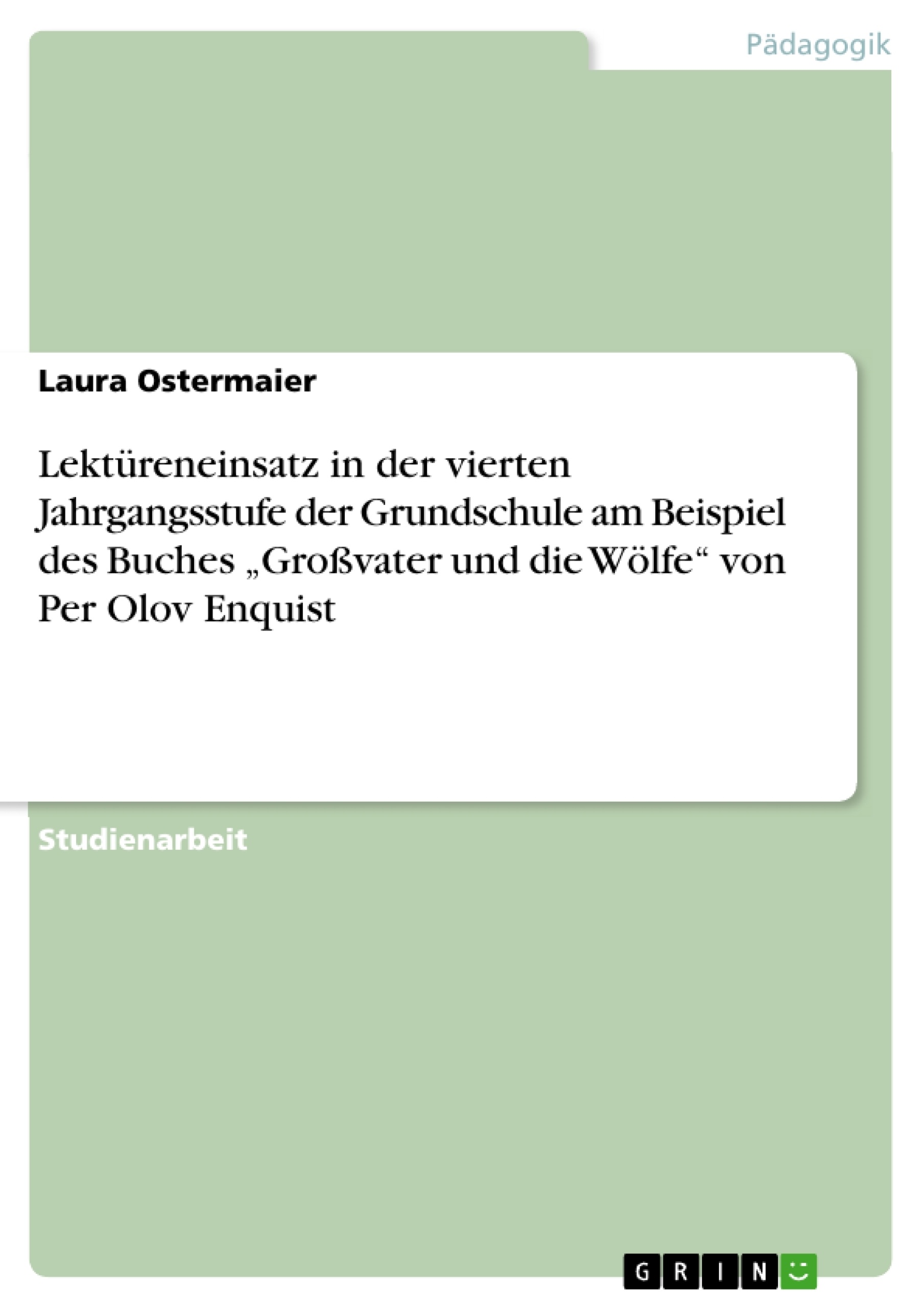„Für den schulischen und beruflichen Erfolg ebenso wie für die Teilhabe am kulturellen, politischen und gesellschaftlichen Leben ist die Beherrschung der Schriftsprache von grundlegender Bedeutung. […] Ein Versagen im Lesen und Schreiben bedeutet für die Betroffenen eine entscheidende (Lern-) Behinderung, die nicht selten aufgrund der damit verbundenen Misserfolgserlebnisse auch Störungen im Bereich der Persönlichkeit und des Verhaltens nach sich zieht.“1
Die PISA-Studie, in der deutsche Schüler der Sekundarstufe auf ihre Lesekompetenz getestet wurden, zeigte, dass das Niveau ihrer Lesekompetenz im internationalen Vergleich eher niedrig und der Anteil von Schülerinnen und Schülern mit sehr schwacher Leseleistung vergleichsweise hoch ist.2
Im Gegensatz hierzu stehen die Ergebnisse der IGLU-Studie: Schülerinnen und Schüler in Deutschland verfügen am Ende der vierten Jahrgangsstufe über vergleichsweise hohe Kompetenzen im Leseverständnis, ihre Leistungen liegen im oberen Viertel bzw. Drittel der teilnehmenden Länder.3 „Am Ende der vierten Jahrgangsstufe müssen Schülerinnen und Schüler in Deutschland internationale Vergleiche nicht scheuen. Die in der Sekundarstufe I und II festgestellten Mängel sind offensichtlich nicht Fortschreibungen von bereits in der Grundschule angelegten Defiziten, sondern in Deutschland primär Resultat der an die Grundschule anschließenden Schulformen.“4
Es wird deutlich, dass Lesen einen wichtigen Stellenwert in unserer heutigen Gesellschaft einnimmt und von Grund auf gefördert werden muss. Eine zentrale Aufgabe der Leseförderung besteht in Aufbau und Sicherung der Lesemotivation; es geht um die Vermittlung von Lesefreude und Vertrautheit mit Büchern, die Entwicklung und Stabilisierung von Lesegewohnheiten.5
Folgende Seminararbeit befasst sich mit dem Einsatz des Buches „Großvater und die Wölfe“ von Per Olov Enquist im Deutschunterricht der vierten Jahrgangsstufe. Die Lektüre soll besonders die Lesemotivation der Schüler verbessern und sie zu einer positiven Grundeinstellung zum Lesen heranführen.
Zunächst wird eine Sachanalyse durchgeführt, um darauf aufbauend eine umfassende didaktische Analyse anzuschließen. Ein weiterer Teil der Arbeit wird die methodische Umsetzung betreffen: Es wird eine Unterrichtssequenz zum Buch vorgestellt, aus welcher zwei Unterrichtsstunden detailliert ausgearbeitet werden.
Inhaltsverzeichnis
0. Vorbemerkung
1. Untersuchungsaspekte im Rahmen der Sachanalyse
1.1 Inhalt
1.1.1 Inhaltsangabe
1.1.2 Inhaltsanalyse
1.1.2.1 Themen des Buches
1.1.2.2 Identifikationsfiguren für die Leser
1.1.2.3 Genre
1.1.2.4 Werte und Normen
1.1.2.5 Verhältnis zwischen Belehrung und Unterhaltung
1.2 Erzähltechnik und Aufbau
1.3 Sprache
1.4 Paratextuelle Merkmale
2. Untersuchungsaspekte im Rahmen der didaktischen Analyse
2.1 Zuordnung der Lektüre zu Schulart und Jahrgangsstufe
2.2 Pädagogisch-psychologische Überlegungen
2.3 Textverständlichkeit
2.4 Textattraktivität
2.5 Textqualität
2.6 Didaktisches Potential
3. Methodische Analyse
3.1 Exkurs: Lesetagebuch
3.2 Erarbeitung einer Unterrichtssequenz zur Lektürebehandlung
3.3 Ausarbeitung zweier Unterrichtsstunden der Sequenz
3.3.1 Erste Unterrichtsstunde: Einführung der Lektüre
3.3.2 Fünfte Unterrichtsstunde: Interview mit den Hauptfiguren
4. Fazit
Literaturverzeichnis
Anhang