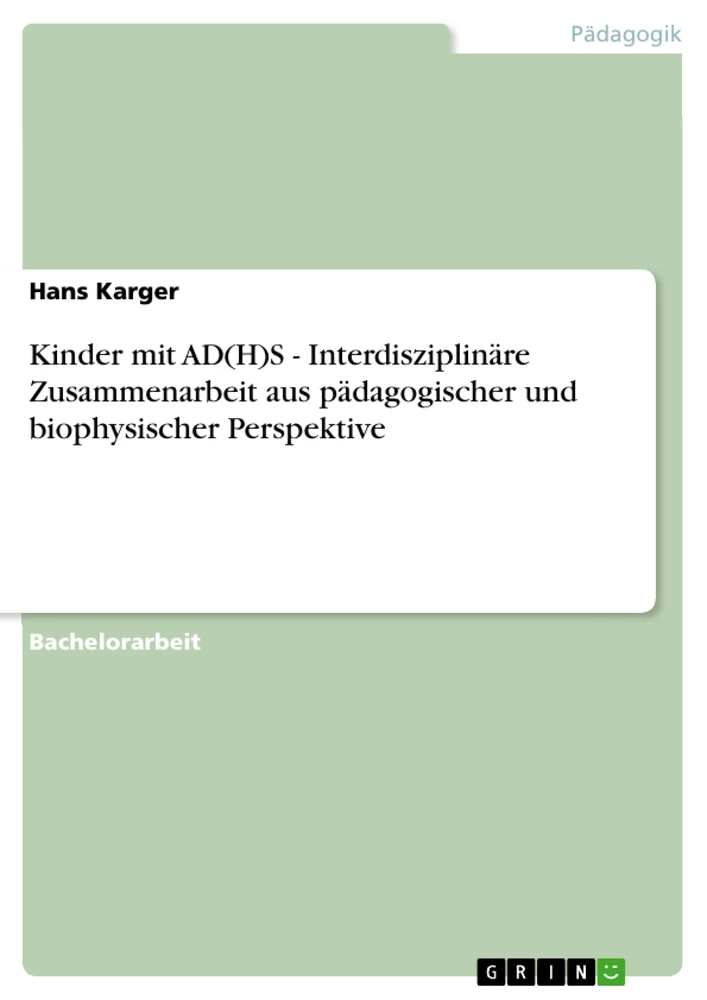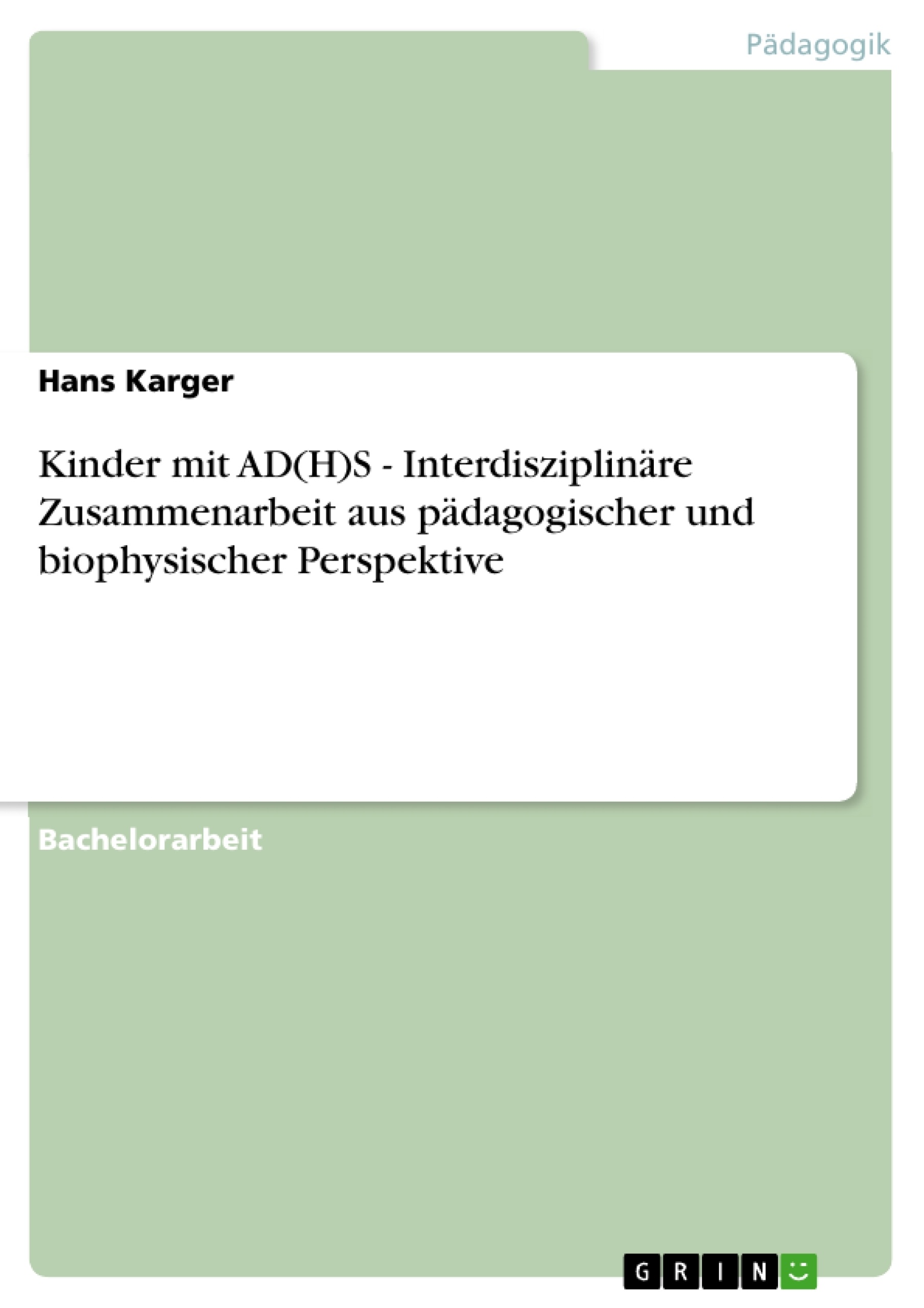In der vorliegenden Bachelorarbeit mit dem Thema „Möglichkeiten und Grenzen der interdisziplinären Zusammenarbeit bei Kindern mit diagnostiziertem AD(H)S im Grundschulalter“ steht die Betrachtung des Erscheinungsbildes Aufmerksamkeitsdefizitstörung mit und ohne Hyperaktivität (AD(H)S) aus unterschiedlichen Perspektiven im Mittelpunkt. Die zentrale Fragestellung dabei ist, wie die Beteiligten und die einzelnen Disziplinen zusammenarbeiten können und müssen, um eine bestmögliche Behandlung zu gewährleisten.
INHALTSVERZEICHNIS
1. EINFÜHRUNG: Ist die Zusammenarbeit ausreichend?
2. AD(H)S - Theoretische Annahmen und deren Bedeutung für die interdisziplinäre Zusammenarbeit
2.1 Definition und Bedeutung des Begriffs Interdisziplinarität für diese Bachelorarbeit
2.2 Klassifikation und Diagnosekriterien
2.2.1 Kategorisierung und Diagnosekriterien nach DSM-IV-TR
2.2.2 ICD-10 im Vergleich mit dem DSM-IV-TR
2.2.3 Epidemiologie und Prävalenz
2.2.4 Begründung der gewählten Abkürzung AD(H)S
2.2.5 Zusammenfassende und kritische Betrachtung der Klassifikationssysteme
2.3 Ätiologie
2.3.1 Ursachen aus biophysischer Sicht
2.3.2 Ursachen aus pädagogischer Sicht
2.3.3 Psychosoziale Einflussfaktoren
2.3.4 Zusammenfassende Betrachtung der Ätiologie unter Hinzunahme des biopsychosozialen Modells
2.4 Zusammenfassende Betrachtung und mögliche Auswirkungen der beschriebenen Klassifikation und Ätiologie von AD(H)S
3. Diagnostik
3.1 Konsequenzen für die interdisziplinäre Zusammenarbeit aus der medizinisch psychiatrischen Diagnostik
3.2 Konsequenzen aus weiteren diagnostischen Verfahren
4. Interventionen
4.1 Medikamentöse Intervention
4.2 Psychoedukation der Eltern, Elterntraining, Elternberatung
4.3 Verhaltenstherapeutische Trainingsprogramme
4.4 Zusammenfassende Betrachtung der Interventionsansätze
5. Resümee
Quellenverzeichnis
Tabellen- und Abbildungsverzeichnis