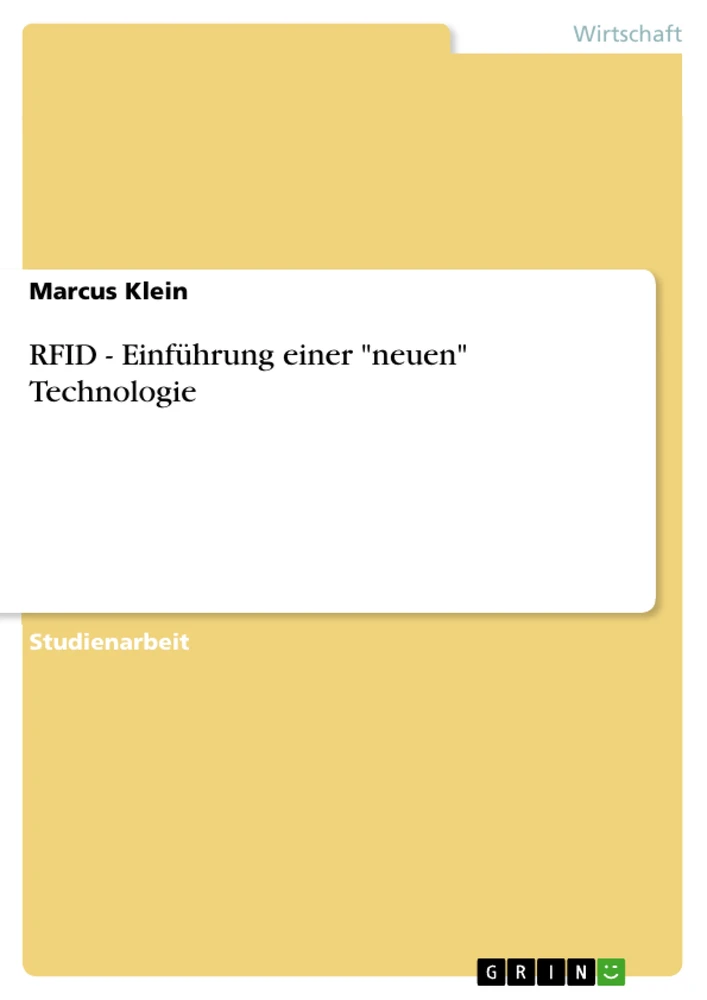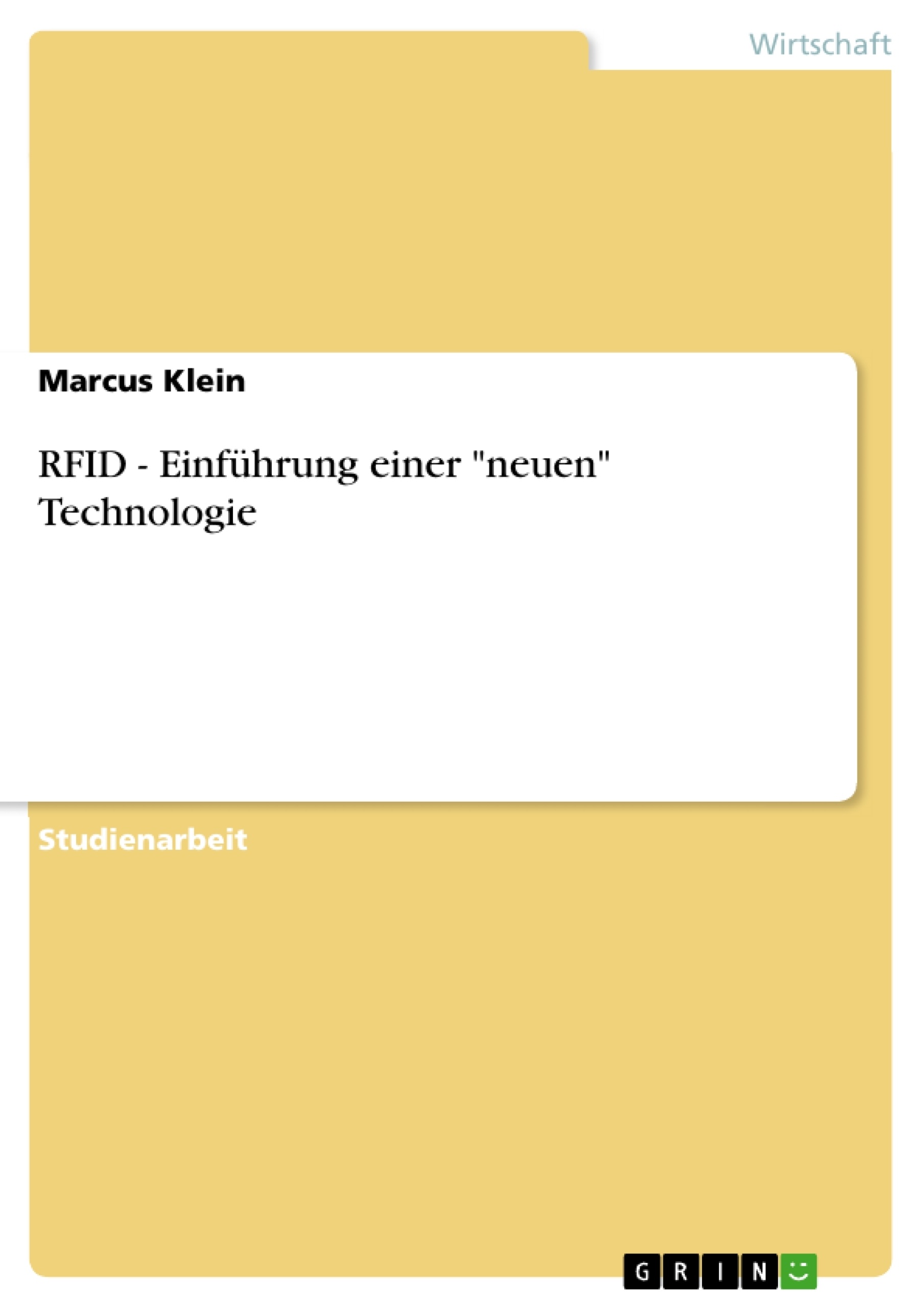RFID (Radio Frequenzy Identification) – eine Technologie, die langsam aber sicher immer größere Bedeutung in unserer Gesellschaft findet.
Schon jetzt wird diese Technologie in vielen Bereichen des täglichen Lebens eingesetzt. Dabei ist der Wunsch nach individuellen Produkten und Belieferungsformen ein wichtiger Treiber dieser Technik.
Der bislang verwendete Barcode zur automatischen Identifikation (Auto-ID) wird mit den wachsenden Anforderungen zunehmend inadäquater. Obwohl der Barcode sehr günstig in der Anwendung ist, liegt seine Schwäche unter anderem in der geringen Speicherkapazität an Information sowie in der Tatsache, dass er sich – einmal am Objekt versehen – nicht wieder umprogrammieren lässt.
Mit dem Ziel den wachsenden Anforderungen, insbesondere der zunehmenden Vernetzung von Wertschöpfungsketten und unternehmensübergreifender Prozesse gerecht zu werden, stellt die RFID-Technologie eine vielversprechende Lösung dar.
Bereits heute ist diese Technologie in unterschiedlichen Branchen der Standard zur Objektidentifizierung.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Geschichte der RFID
1.2 Struktur der Arbeit
2 Grundlagen der RFID
2.1 Einführung in die RFID-Technologie
2.2 Aktive und passive RFID-Systeme
2.3 Offene und geschlossene RFID-Systeme
2.4 Versuch der Standardisierung
3 Einsatzmöglichkeiten der RFID-Systeme
3.1 RFID im Logistikbereich
3.2 RFID im Handel
3.3 RFID zur Personenidentifikation
4 Risiken/Schwächen der RFID-Technologie
4.1 Wirtschaftliche Rentabilität
4.2 Technische Realisierbarkeit
4.3 Gesellschaftliche Akzeptanz
4.3.1 Sicherheit
4.3.2 Datenschutz und Privatsphäre
5 Fazit
Anhang
Literaturverzeichnis