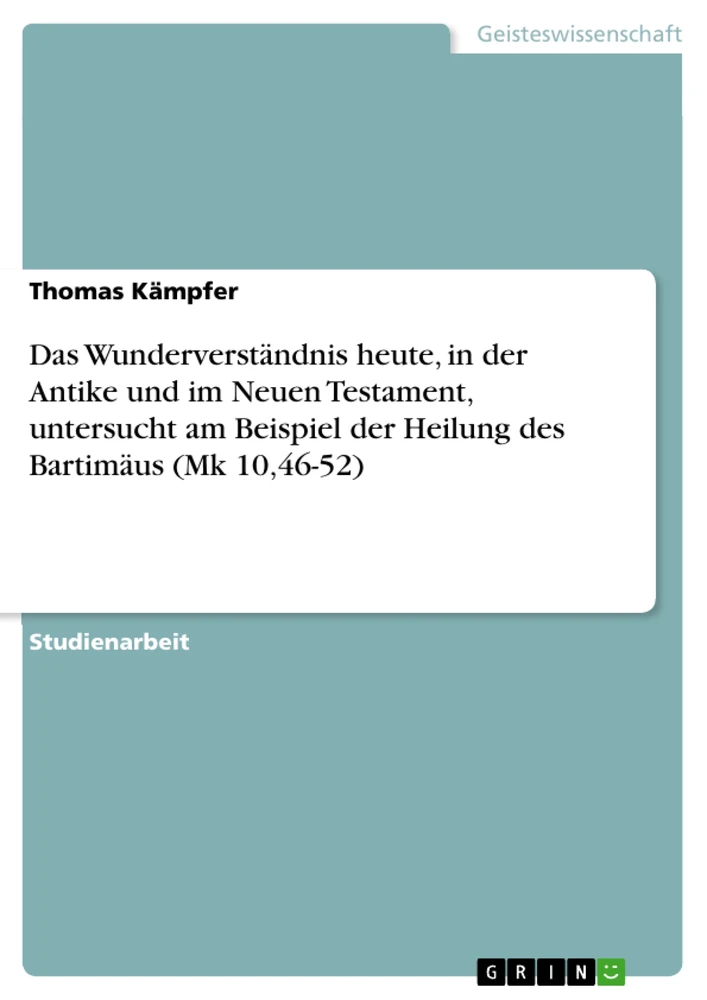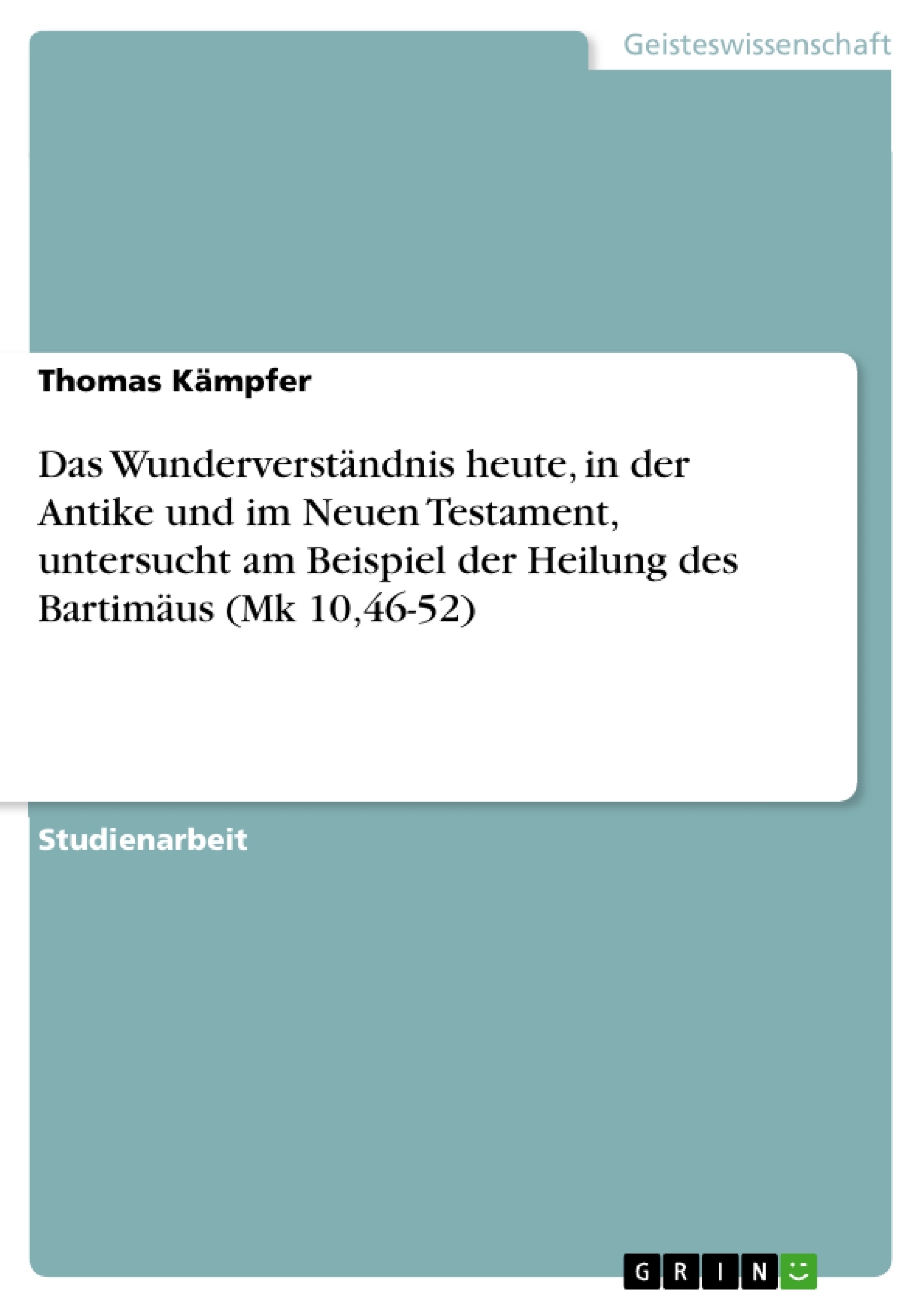„Wunder gibt es immer wieder…“, „Das Wunder von Bern“, „Das Wunder von Lengede“ – diese Phrasen, Schlagworte oder Textfragmente sind so oder in der Art immer wieder in den Medien, in Texten von Liedern, als Titel von Filmen oder ähnlichem zu finden. Immer dann, wenn etwas geschieht, dass die Menschen nicht sofort erklären können oder was so nicht zu erwarten war, wird sehr schnell der Begriff des Wunders bemüht. Nicht erst seit dem sehr raschen Prozess der Seligsprechung Johannes Pauls II mit der damit einhergehenden Suche nach einem mit diesem im Zusammenhang stehenden Wunders wird die Frage nach der Existenz solcher Wunder auch in nicht-religiösen Kreisen sehr intensiv diskutiert.
Darüber, ob es Wunder gibt und wie sie zu deuten und zu verstehen sind, wurden bereits tausende von Büchern und Abhandlungen geschrieben. Die vorliegende Arbeit möchte sich deshalb der Fragestellung widmen, wie sich das Verständnis von Wunder in der Antike, im Neuen Testament und im heutigen Verständnis voneinander unterscheiden. Zu diesem Zweck werde ich zunächst das Wunderverständnis der Antike genauer untersuchen und einem möglichen modernen Wunderverständnis gegenüberstellen. In einem zweiten Schritt werde ich dem antiken, nicht-biblischen Wunderverständnis ein Verständnis entgegen setzen, dass sich aus den Schriften des Neuen Testamentes heraus ergibt. Dabei werde ich mich im Speziellen auf die Erzählung der Heilung des Bartimäus (Mk 10, 46-52) beziehen und an dieser die aufgestellten Fragen versuchen zu klären.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Was ist ein Wunder?
Wunder im heutigen Verständnis
Wunderverständnis der Antike
Das Wunder im Neuen Testament
Begriffliche Schärfung und Abgrenzung
Wunder als Zeichen
Heilungswunder
Die Heilung des blinden Bartimäus Mk 10,46-
Erste Einordnung dieser Erzählung in den Gesamtkontext des Evangeliums
Innere Gliederung: Markus 10,46-
Vergleich mit antiken Wundergeschichten
Die Bartimäus-Erzählung als Wendepunkt im Markus-Evangelium
Fazit
Literaturverzeichnis