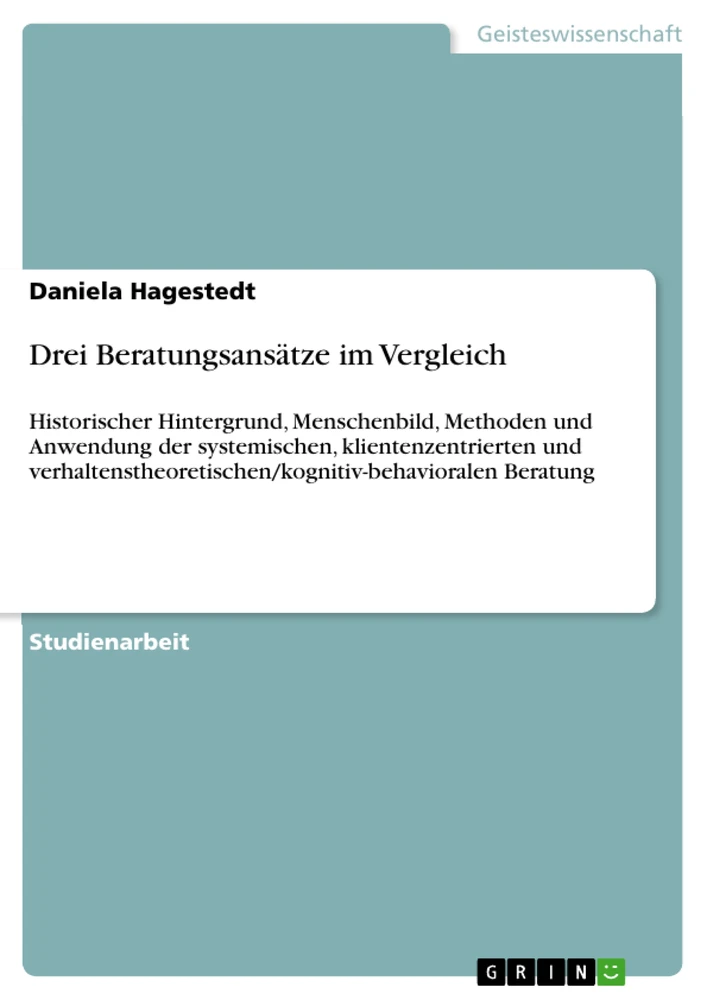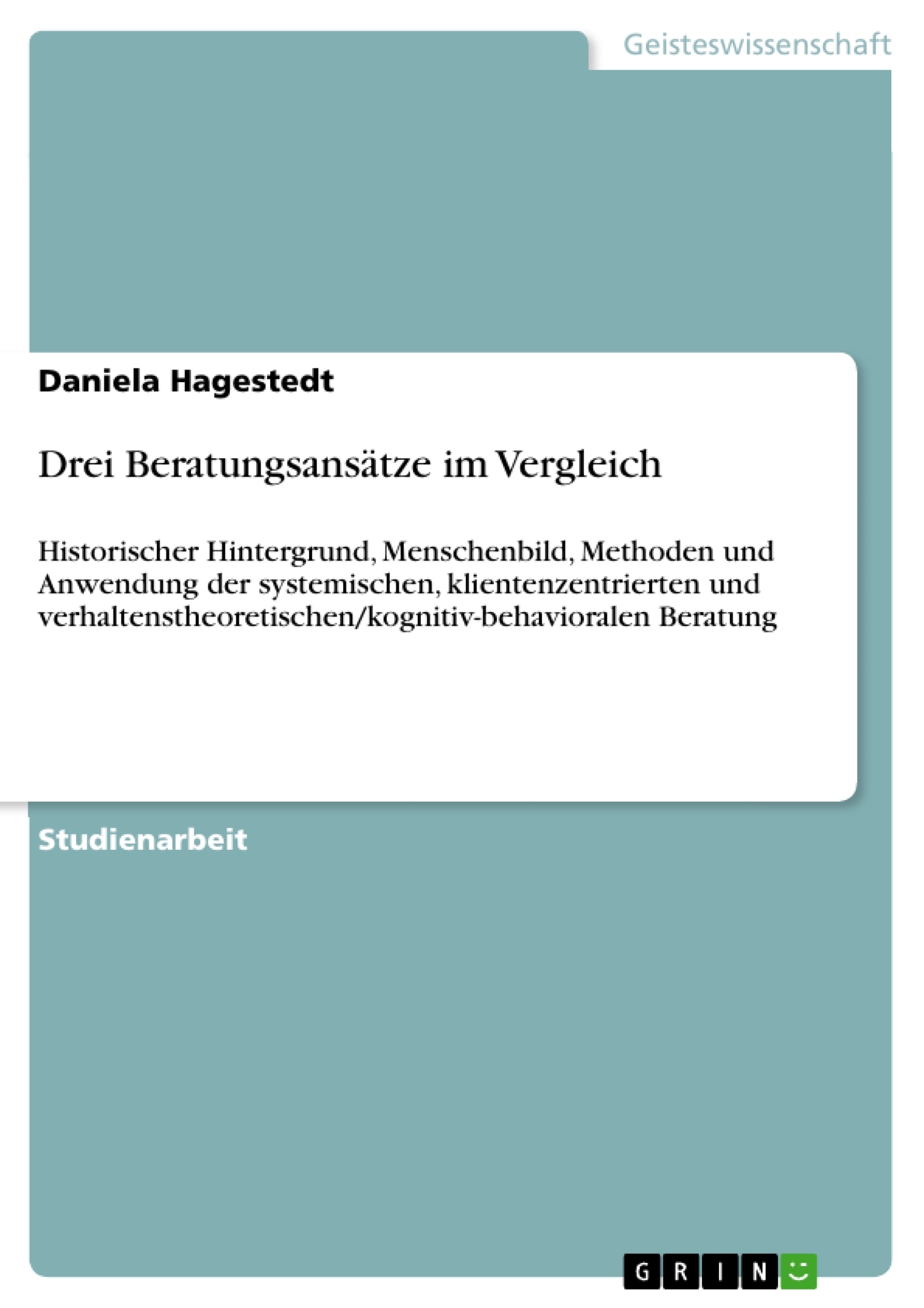Es existiert eine Vielzahl psychologischer Theorien und Ansätze, aus denen sich im Laufe der Zeit diverse Beratungs- und Therapieformen entwickelten, die teils mehr, teils weniger in der Praxis angewendet werden. Alle diese Ansätze haben einen gemeinsamen Ausgangspunkt: Sie wollen den Menschen helfen bestehende Probleme zu lindern bzw. zu beheben. Dies wird jedoch sowohl in der Therapie, als auch in der Beratung auf unterschiedlichste Art und Weise zu erreichen versucht. Die vorliegende Arbeit betrachtet drei dieser Ansätze im Beratungsfeld: Die systemische Beratung, die klientenzentrierte Beratung und die verhaltentheoretische bzw. kognitiv-behaviorale Beratung. Es soll gezeigt werden inwieweit sich diese Ansätze ähneln und in welchen Punkten sie sich unterscheiden. Im ersten Abschnitt wird kurz auf die wichtigsten historischen Entwicklungen der drei Ansätze eingegangen, um danach die den Konzepten zugrunde liegenden Theorien näher zu beschreiben und zu vergleichen. Im Anschluss daran soll gezeigt werden, dass die unterschiedlichen theoretischen Grundlagen der drei Ansätze sich auch in ihrer Anwendung und ihren spezifischen Methoden niederschlagen. In einem abschließenden Fazit werden die wichtigsten Unterschiede der Beratungsansätze noch einmal kurz dargestellt, sowie wichtige Anwendungsbereiche im pädagogischen Feld skizziert.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Historische Entwicklung
2.1 Die klientenzentrierte Beratung
2.2 Die verhaltenstheoretische/kognitiv-behaviorale Beratung
2.3 Die systemische Beratung
3 Theorie und Menschenbild
3.1 Die klientenzentrierte Beratung
3.2 Die verhaltenstheoretische/kognitiv-behaviorale Beratung
3.3 Die systemische Beratung
4 Methoden und Anwendung
4.1 Die klientenzentrierte Beratung
4.2 Die verhaltenstheoretische/kognitiv-behaviorale Beratung
4.3 Die systemische Beratung
5 Fazit
Literaturverzeichnis