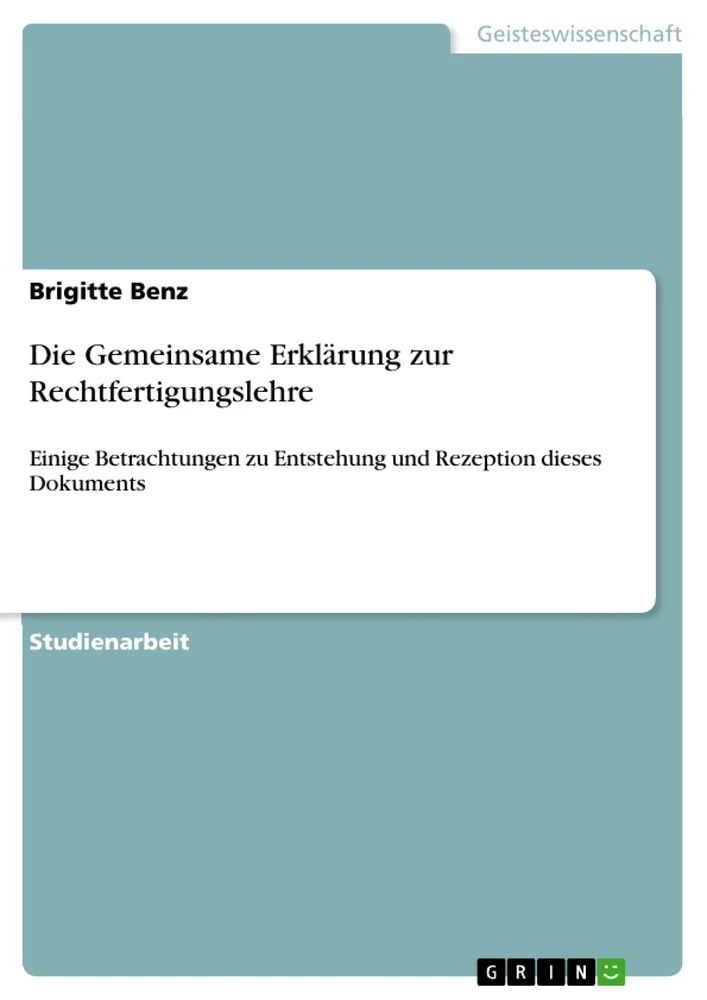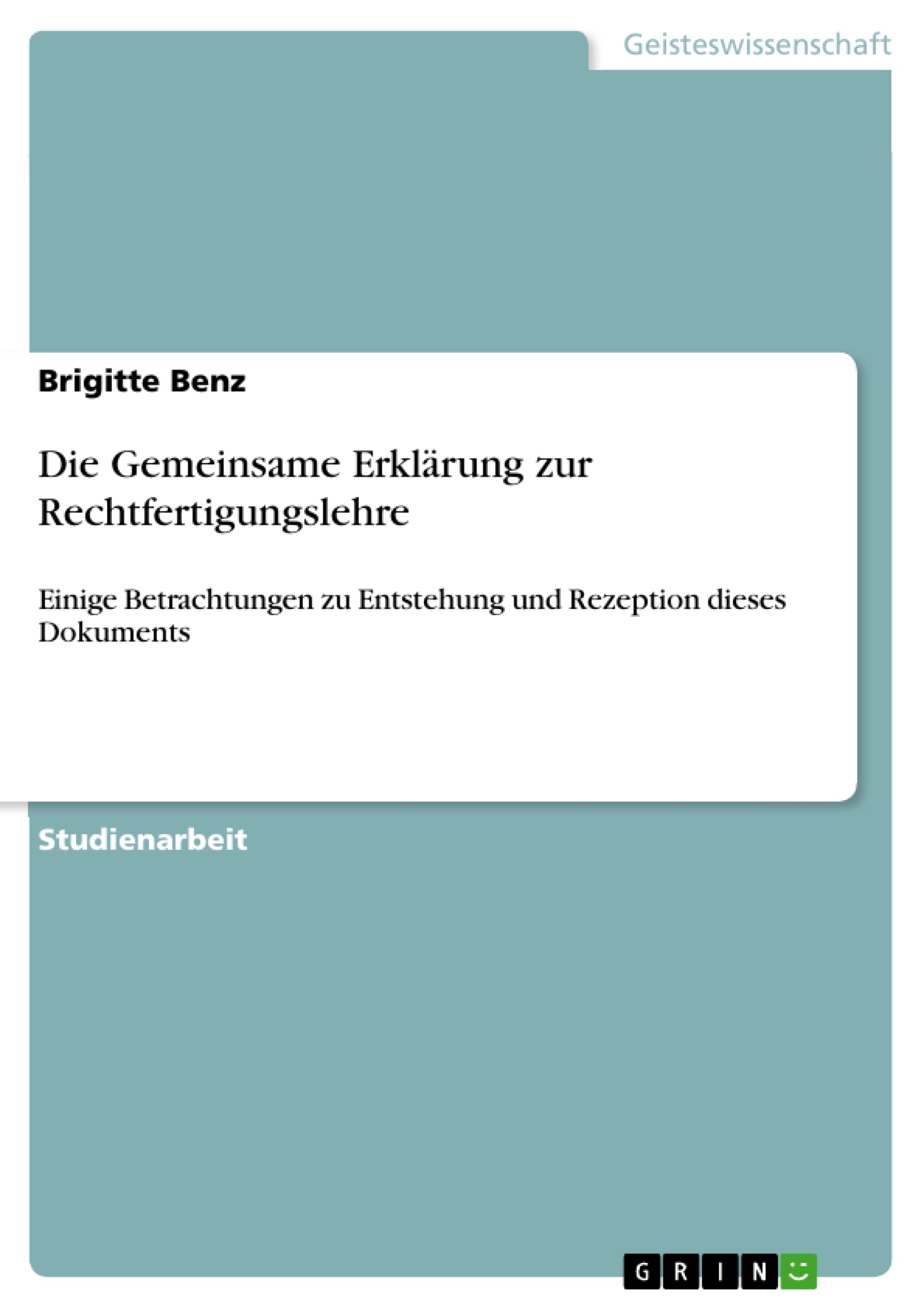Das unterschiedliche Verständnis in Bezug auf die Rechtfertigungslehre wurde seit dem 16. Jahrhundert als ein wesentlicher Punkt für die bleibende Trennung der Konfessionen betrachtet. Heute setzen sich viele Christen in der Ökumene für eine Widerannäherung der christlichen Konfessionen ein. Die zunehmenden Bemühungen des letzten Jahrhunderts um eine Verbesserung der Ökumene hatten auch das Ziel, dort wo möglich gegenseitige Lehrverurteilungen aufzuheben. Ein erstes konkretes Ergebnis dieser Anstrengungen ist die Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre (im folgenden GE), welche 1999 vom Lutherischen Weltbund und der Katholischen Kirche verabschiedet wurde.
Die vorliegende Arbeit hat zum Ziel, einige Überlegungen zu dieser Erklärung anzustellen. Dabei soll es um die Geschichte der GE gehen und darum, welche Reaktionen es in Bezug auf die GE von lutherischer und katholischer Seite gab. Bei den Reaktionen wird sich diese Arbeit neben den offiziellen Stellungnahmen beider Dialogpartner auf Meinungsäußerungen aus Deutschland beschränken.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Die Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre
2.1. Vorgeschichte und Entstehung des Textes
2.2. Aufbau und Themen der Gemeinsamen Erklärung
2.3. Einige Reaktionen auf die Gemeinsame Erklärung
2.3.1. von evangelischer Seite
2.3.2. von katholischer Seite
2.3.3. aus Anlass des zehnten Jahrestages der Unterzeichnung der GE
3. Resümee
Literaturverzeichnis