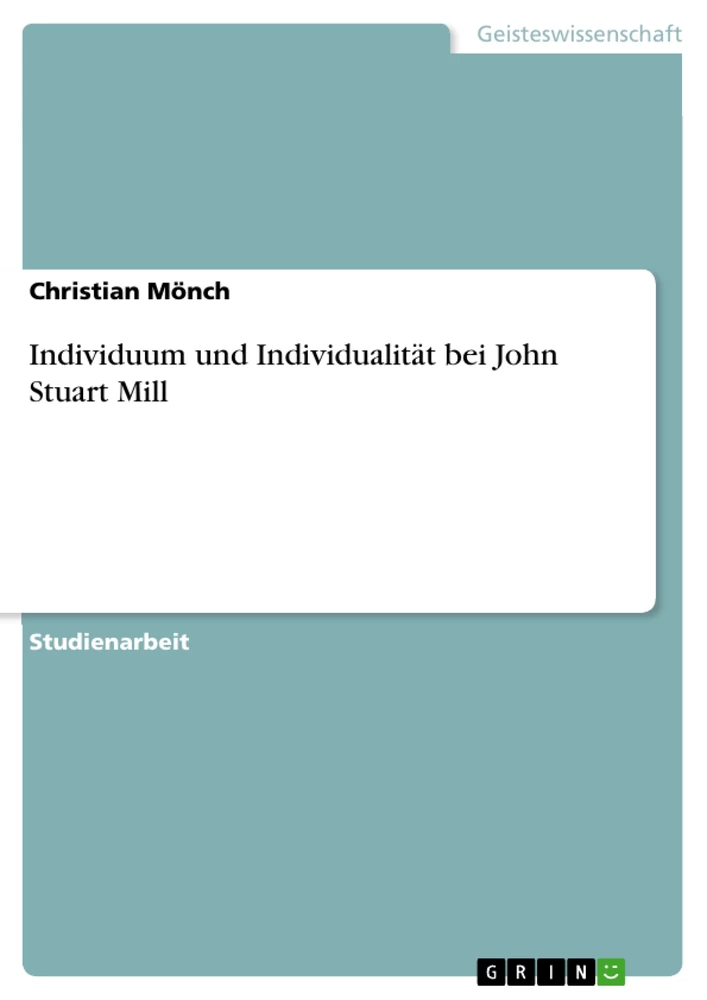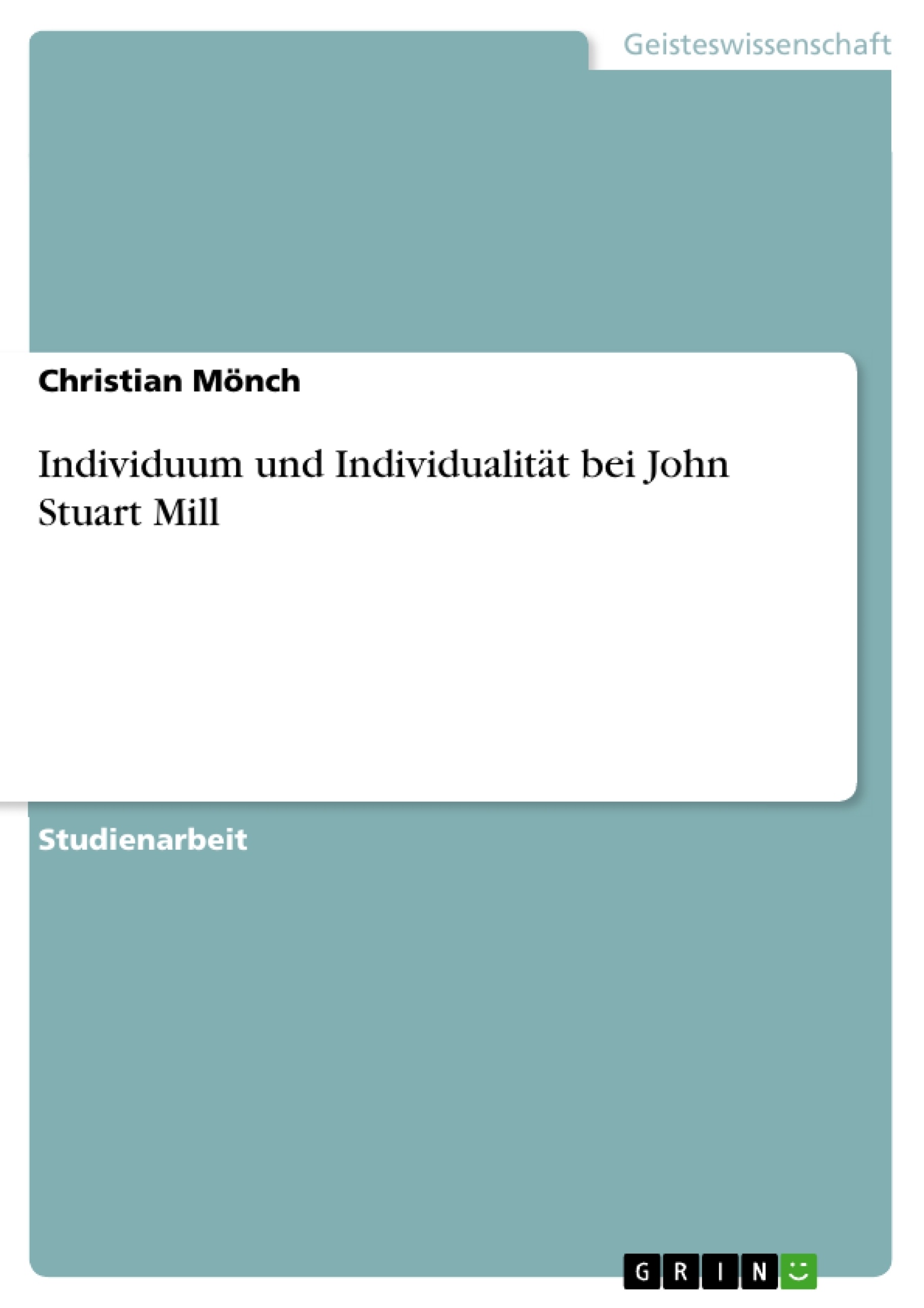Der Text gibt einen Einblick in die Ausführungen John Stuart Mills bezüglich Individuum und Individualität und hinterfragt diese kritisch.
Verzeichnis des Inhalts
Zum Begriff der Individuation
Zu den Begriffen Individuum und Individualist
Individuum und Individualist bei Mill
Stellungnahme des Autors
Literaturverzeichnis
Ende der Leseprobe aus 15 Seiten
- nach oben