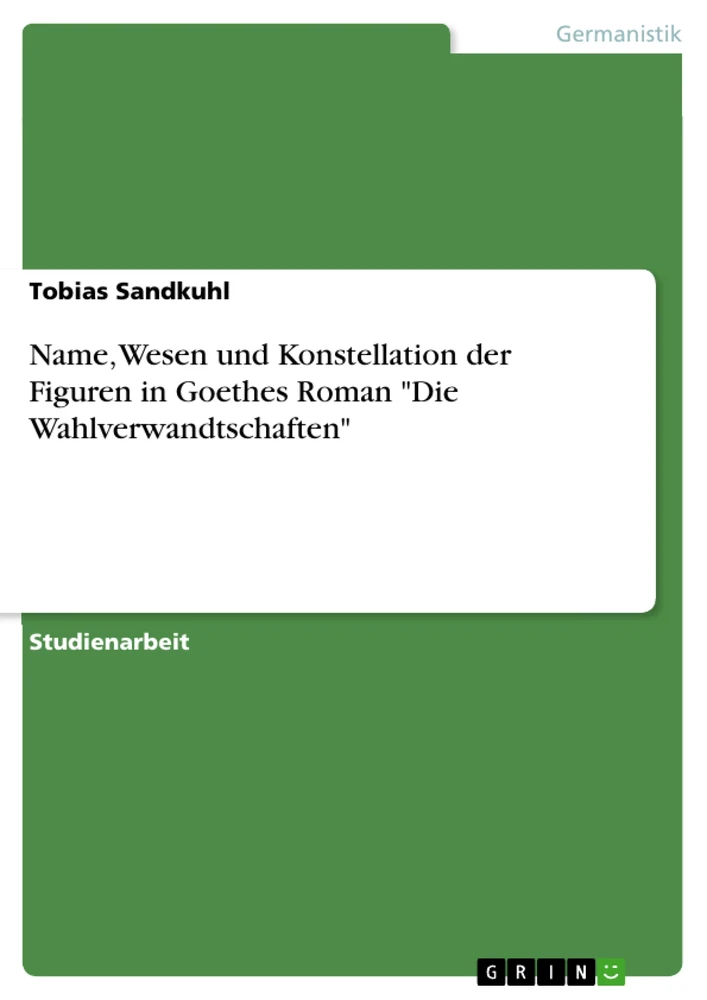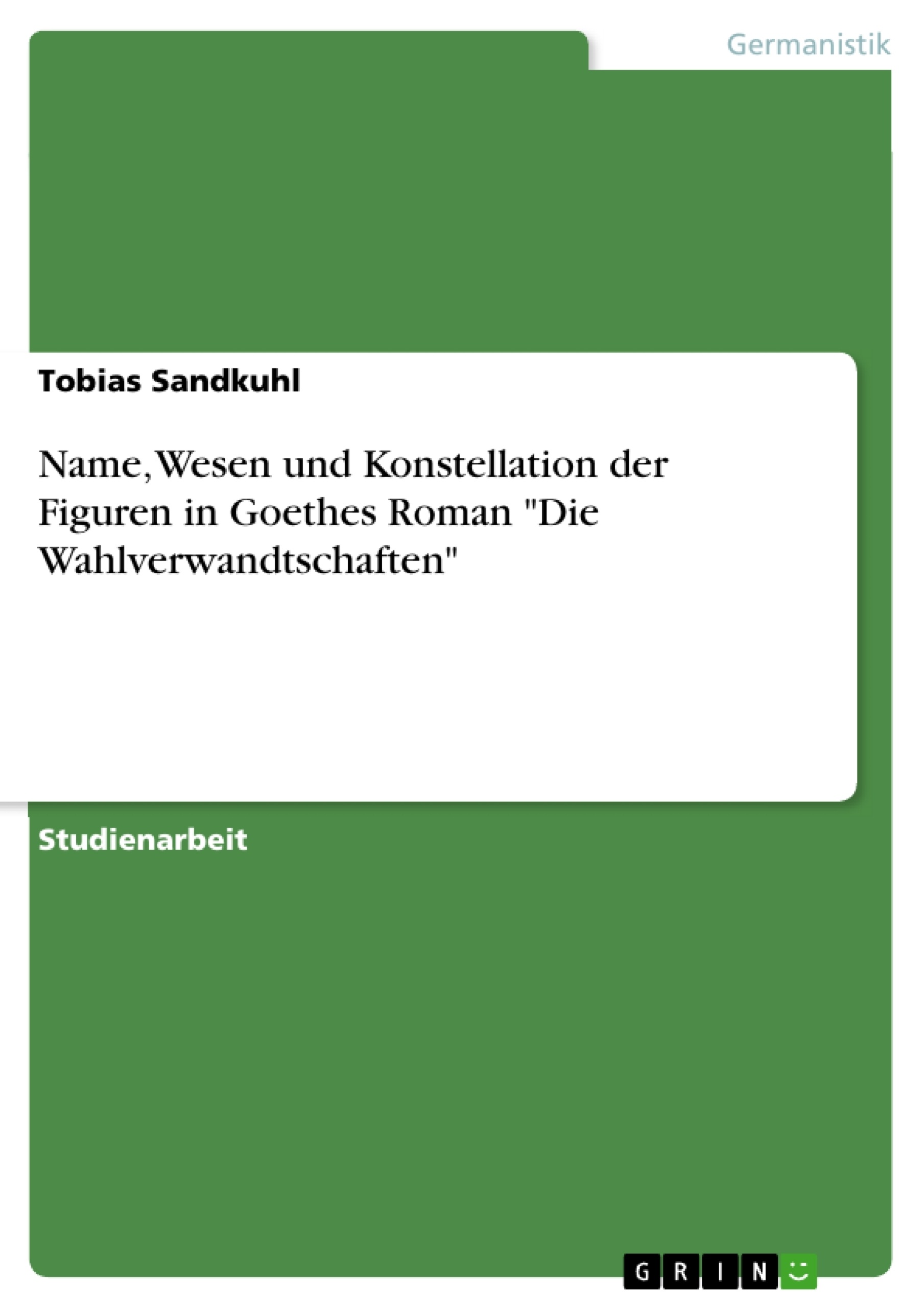‚Die Wahlverwandtschaften’ von Johann W. Goethe ist einer der am vielschichtigsten konstruierten Romane der deutschen Literatur. Die Deutung des Romans ist bis heute nicht abgeschlossen und immer wieder entdeckt die literaturwissenschaftliche Forschung neue Facetten dieses Werkes. Eine dieser Mosaiksteine, den man als Leser, Kritiker und Forscher beachten muss, wenn man den Roman verstehen möchte, ist die Bedeutung der Namen.
In den Fokus der Literaturwissenschaft sind Namen durch die Erkenntnis geraten, dass sie ein bewusstes gestalterisches Mittel in einem modernen Roman sein können. Des Weiteren erfüllen Namen bzw. die Benennung von Figuren oder der Verzicht darauf, in einem Roman immer ganz bestimmte Zwecke. Der Bedeutung von Namen in literarischen Texten widmet sich eine ganze Forschungsdisziplin, die so genannte ‚Onomastik’. Auf diese werde ich im ersten Kapitel dieser Arbeit eingehen.
Das Besondere der Namen in den Wahlverwandtschaften ist der immens wichtige Stellenwert, den Goethe ihnen durch Gestaltung und Bedeutung gibt. Denn jede Figur, die einen Eigennamen besitzt, wird durch diesen auch in ihrem Wesen determiniert und charakterisiert. In den Wahlverwandtschaften geht die Namensbedeutung über das normale Maß, wie man es in den meisten anderen Romanen vorfindet, hinaus. Die Namen dienen nicht nur der Identifizierung der auftretenden Figuren, sondern auch zu einigen anderen Zwecken. Diese Multifunktion der Namen im Roman aufzuzeigen und zu interpretieren, ist Inhalt und Ziel dieser Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1. Die Bedeutung von Namen in literarischen Werken
2. Die Hauptfiguren der Wahlverwandtschaften
3. Die chemische Gleichnisrede
3.1 Entwicklung der chemischen Gleichnisrede
3.2 Namen und Zeichen in der Gleichnisrede
4. Die Nebenfiguren der Wahlverwandtschaften
4.1 Luciane
4.2 Mittler
4.3 Nanny
Zusammenfassung
Literatur