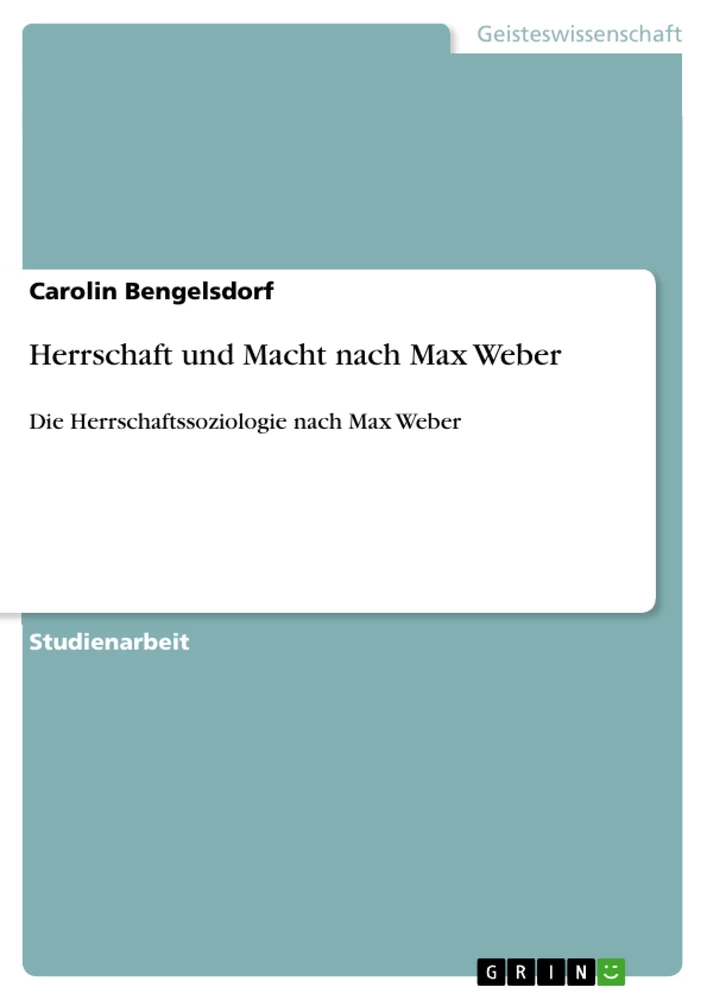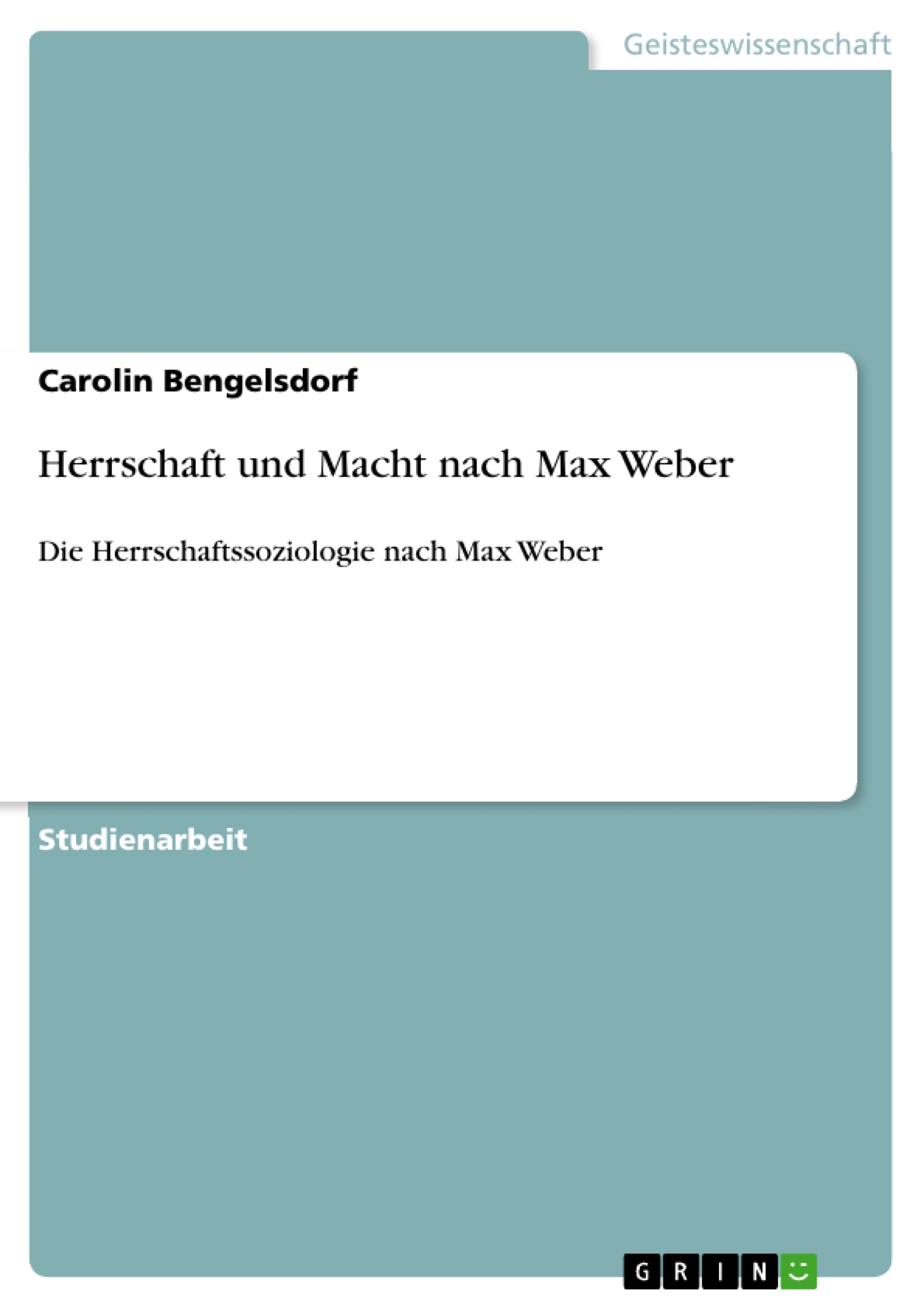Im Rahmen der Soziologie wird der Begriff der Herrschaft klassischerweise als ein zentraler Mechanismus der sozialen Handlungsregelung verstanden. Weiterhin findet sich in der soziologischen Diskussion die Verknüpfung von Herrschaft mit sozialer Ungleichheit, Ausbeutung und Unterdrückung. Zum einen postuliert die Soziologie für die moderne Gesellschaft einen angestiegenen Bedarf an sozialen Regelungen der Handlung, kritisiert zum anderen die Beschränkungen individueller Freiheiten der Handlung und die sozialen Folgen, die oft mit dem Ausbau von Hierarchien und formal-hierarchischen Organisationen einhergehen. Diese Ambivalenz durchzieht die Herrschaftssoziologen seit langem. Die Phänomene der Herrschaft und der Hierarche sind altbekannt und es wurde bereits in der Antike darüber nachgedacht und philosophiert. Jedoch wird erst in der modernen Sozial-theorie im Rahmen der Vorstellung freier und gleicher Menschen Herrschaft zum Gegenstand kritischer Anfragen erhoben und die Suche nach deren Grundlagen eröffnet. Die Grundlagen der modernen Herrschaftssoziologie hat Max Weber geschaffen. Das Forschungsfeld wurde durch ihn abgesteckt und mit dem Modell der Herrschaft kraft Autorität lange Zeit das soziologische Forschungsprofil geprägt. Der Begriff der Herrschaft ist nach Weber eine Form der sozialen Regelung und Beziehung, welche im widerspruchsfreien Befehlen und Gehorchen Einzelner zum Ausdruck kommt. Herrschaft unterscheidet sich von zufälligen Macht- oder Gewaltbeziehungen und weist eine soziale Ordnungsform auf, die das soziale Handeln der Einzelnen erwartbar regelt und damit soziale Koordination bewirkt. Im Rahmen des Konzepts der Herrschaft kraft Autorität hat er sozial geregelte Beziehungen der Herrschaft in den Mittelpunkt soziologischer Analysen gerückt und in deren Institutionalisierung die entscheidende Erfolgs- und Bestandschance gesehen. Im Gegensatz zur Macht definiert Weber Herrschaft als die Möglichkeit, für einen bestimmten Befehl bei bestimmten Personen Gehorsam zu finden. Somit stellt Herrschaft eine vertikale und asymmetrische soziale Beziehung dar, in der es ein Befehlen und ein Gehorchen gibt. Macht hingegen ist die bloße Möglichkeit, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben anderer durchsetzen zu können. Macht prägt das soziale Handeln, bildet aber an sich keine soziale Beziehung. Im Rahmen dieser Hausarbeit soll sich mit der Herrschaftssoziologie nach Max Weber näher beschäftigt werden.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Ein Zugang zur Thematik der Soziologie als Wissenschaft vom sozialen Handeln
3. Die Begriffe Macht und Herrschaft nach Max Weber
3.1. Macht - ein soziologischer Grundbegriff.
3.2. Eine Annäherung an den Begriff der Herrschaft
3.3. Die drei Herrschaftsformen
3.3.1. Die rational-legale Herrschaft
3.3.2. Die traditionelle Herrschaft
3.3.3. Die charismatische Herrschaft
4. Exkurs: Herrschaft und Wissen
5. Schlussbetrachtung
Literaturverzeichnis