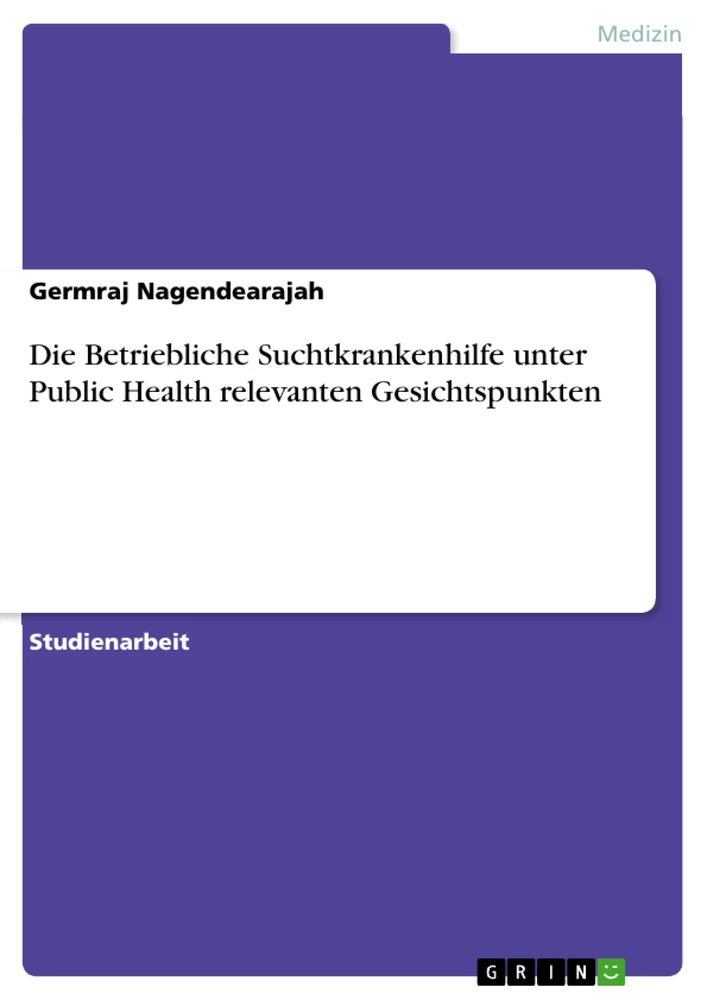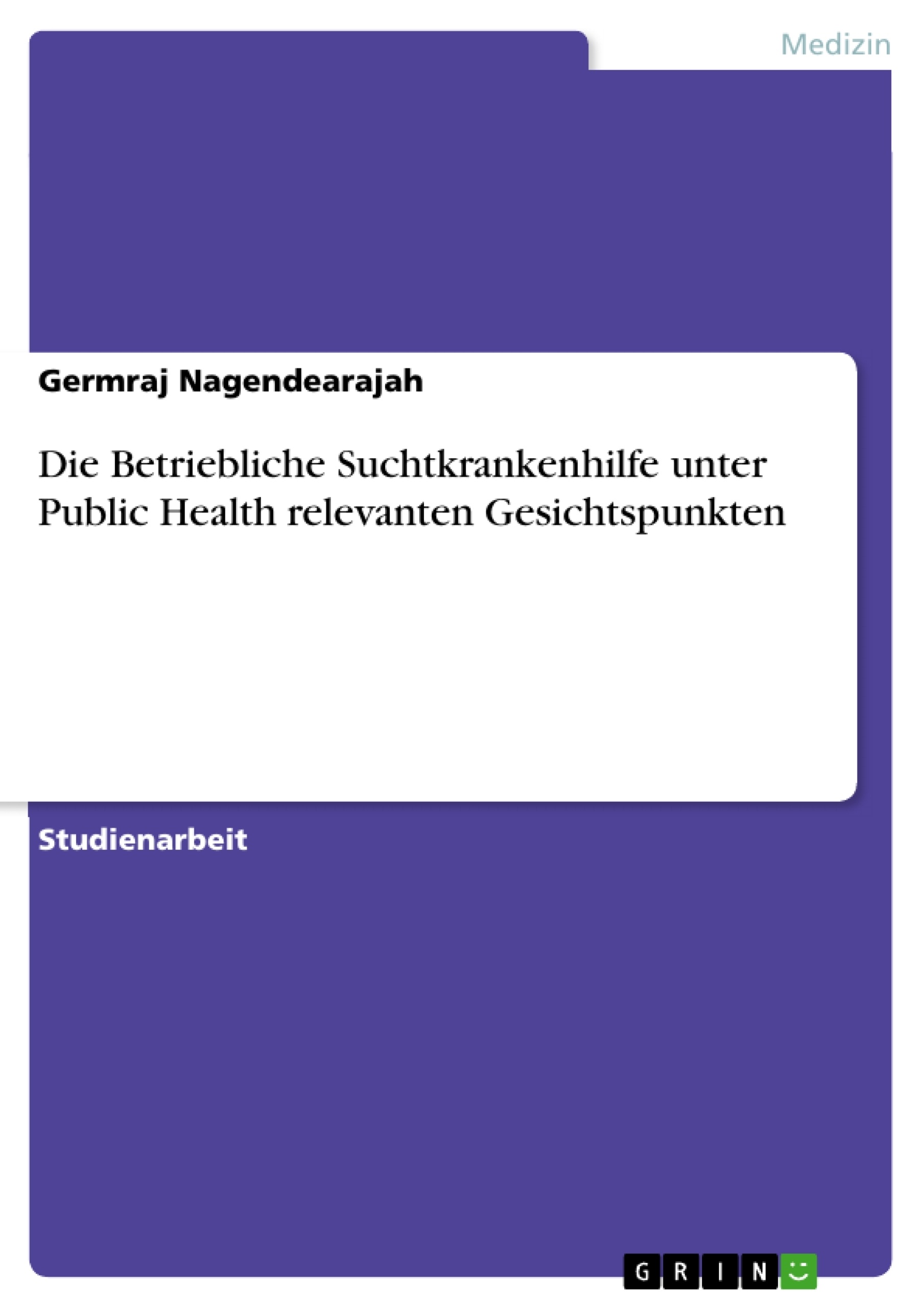Badura et al. (2010, S. 11) sehen „Gemeinsinn, Solidarität und moralisches Bewusstsein“ als „Kern sozialen Zusammenhalts“. Denn dies lässt nach ihrer Überzeugung weder „staatlich anordnen noch am Markt erwerben“(Badura et al., S. 11). Zusätzlich warnen sie (Badura et al., S. 11) vor der in dem aktuellem Zeitgeist steckenden Profitgier und deren Konsequenzen wie Vernichtung von Sozialkapital und die Infragestellung von den eigenen Handlungsgrundlagen. In diesem Kontext eingebettet, erscheint es nicht besonders überraschend, dass der Beschäftigte heutzutage mehr potentiellen gesundheitlichen Risikofaktoren ausgesetzt ist.
Enderle und Seidel (2004, S. 171) haben den Eindruck, dass „die betriebliche Suchtkrankenhilfe einen besonderen Stellenwert und besondere Möglichkeiten“ anbieten, da aus ihrer Perspektive Suchtkranke in der Regel „erst in einer späten Phase der Erkrankung Leidensdruck“ empfinden.
Die Belegschaft und das Unternehmen lassen sich als eine Art symbiotischer Beziehung beschreiben. Auf der einen Seite beschäftigen Betriebe Mitarbeiter beispielsweise um Produkte herzustellen oder Dienstleistungen anzubieten. Auf der anderen Seite ist der Beschäftigte interessiert, durch seine Arbeitskraft und den dadurch erworbenen Lohn, seine Existenz zu sichern.
Deutschland ist eine Hochleistungsgesellschaft, dies verdankt sie nicht zuletzt ihrer Stellung als Industrienation. Aus dieser Annahme resultieren starke Beanspruchungen für Arbeiter nahezu aller Branchen. Daher ist es mehr als essentiell die Ressourcen der Beschäftigten zu fördern bzw. die Mitarbeiter zu befähigen mehr Verantwortung, insbesondere über ihre Gesundheit, zu übernehmen.
Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mit Suchterkrankungen in Betrieben und es stellt sich die Frage, welche Determinanten maßgeblich das Auftreten von Suchterkrankungen in Betrieben bestimmen. Welche Anzeichen, Faktoren sind in ätiologischer Fragestellung zu berücksichtigen? Welche Interventionsmöglichkeiten sind gegeben? Dabei wird das Augenmerk auf stoffgebundene Süchte begrenzt.
Inhalt
1. Einleitung
2. Begriffsbestimmung Sucht
2.1 Ursachen und Hintergründe von Suchtmittelmissbrauch und -abhängigkeiten im Betrieb
2.2 Verhaltensweisen Suchtmittelabhängiger im Betrieb
2.3 Folgen für den Betrieb
2.4 Innerbetriebliche Strategien: Maßnahmen und Interventionen gegen Suchterkrankungen
3. Fazit
Literaturverzeichnis
Internetquellen