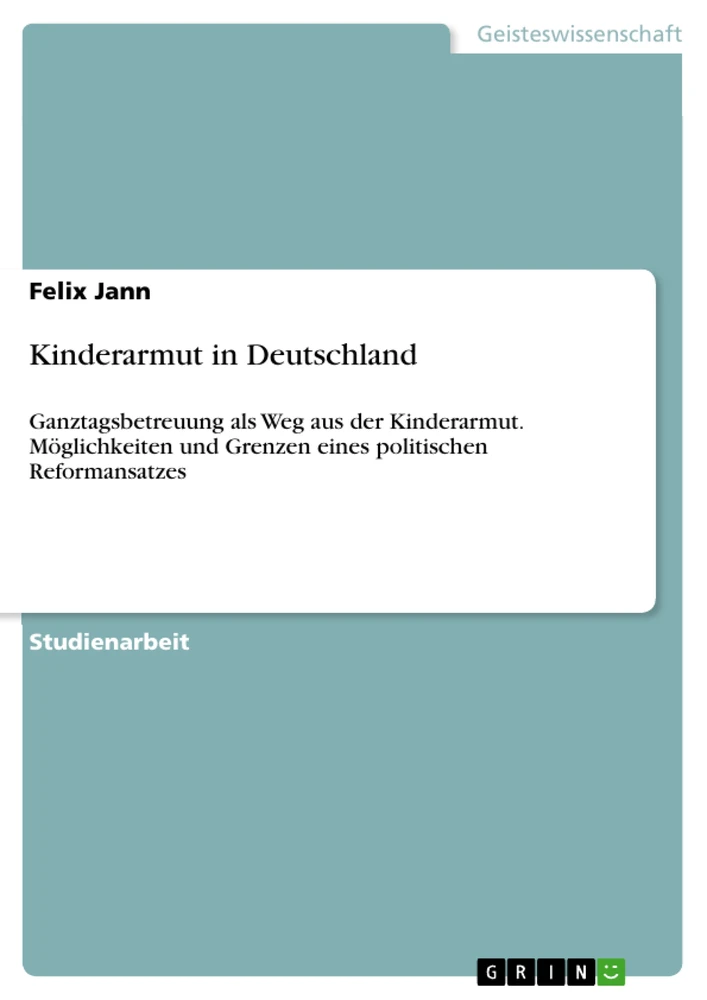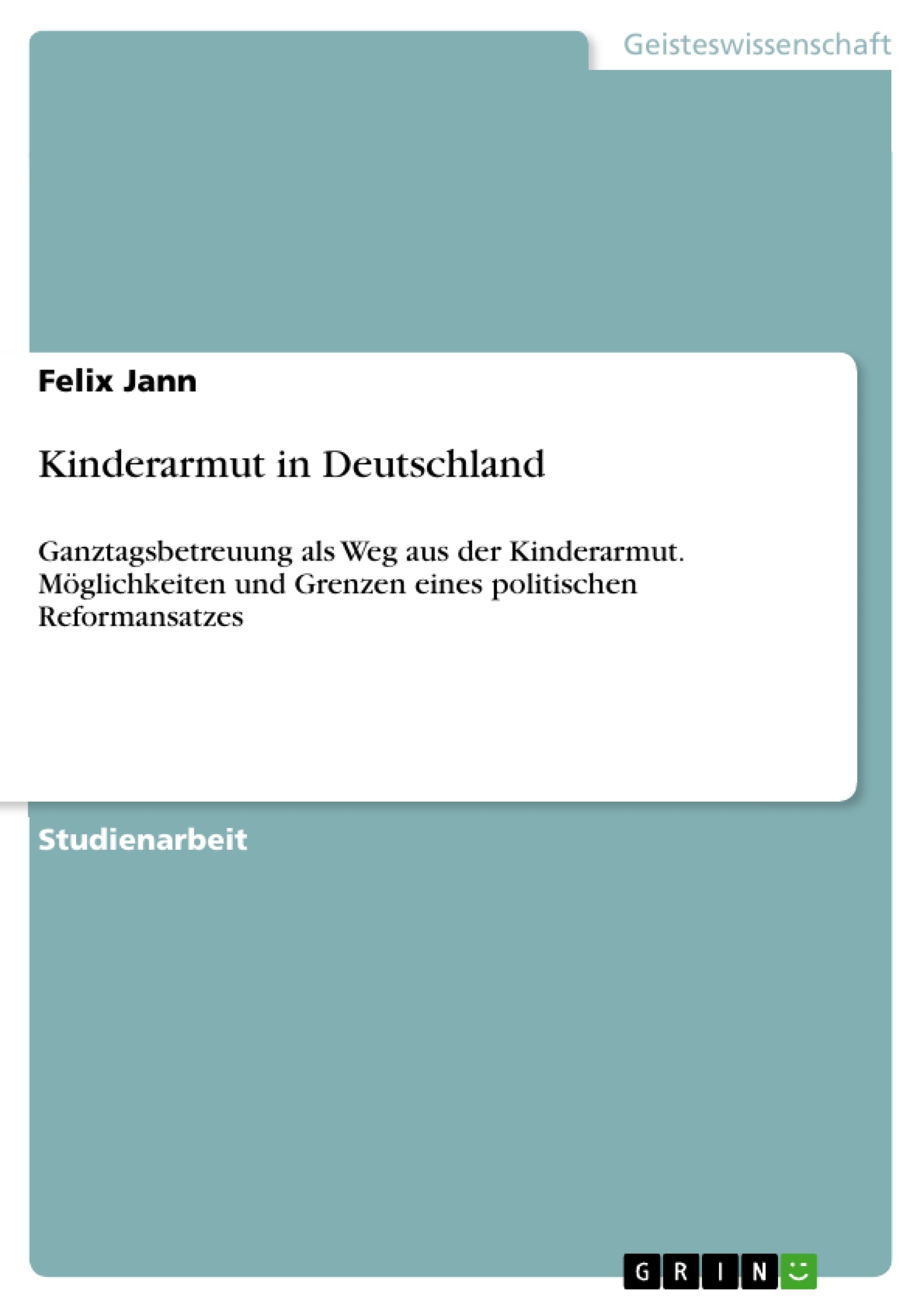Eine Schülerin der 8. Klasse aus dem Bundesland Brandenburg wurde gefragt, wie sie sich Verhalten würde, wenn sie von Armut betroffen wäre. Sie sagte, dass sie es lange nicht glauben würde und darüber sehr traurig wäre. Sie würde es zunächst für sich behalten, bevor sie es ihrer besten Freundin anvertrauen würde. Armut macht betroffen und stumm. (Vgl. Butterwegge 2000, S. 270)
Diese Aussage verdeutlicht, dass Armut ein Tabuthema in unsere Gesellschaft ist und dass man versucht, es so lange wie möglich, für sich zu behalten. Aufgrund dieser Tatsache muss über Armut gesprochen werden, um Veränderungen herbeizuführen.
Nach wie vor leugnet bzw. verdrängt die Gesellschaft das Problem der Kinderarmut (vgl. Butterwegge, Klundt, Zeng 2005, S. 10).
Mehr als 2,5 Millionen Mädchen und Jungen, also etwa jedes sechste Kind, leben in Deutschland von Sozialhilfe und damit in Armut. Das geht aus einem Bericht des “Kinderreports 2007“ des Kinderhilfswerks hervor. (vgl. SPIEGEL-ONLINE 2010).
In diesem Zusammenhang stellt sich zwangsläufig die Frage, was gegen die zunehmende Verarmung von Kindern und deren Familien getan werden kann.
Gerade Kinder bedürfen der Zuwendung und Hilfe, denn sie sind es, die ohne ihr Zutun in Armut geraten und leiden stärker als Erwachsene unter deren Folgen (vgl. Butterwegge 2000, S. 271).
Ein Lösungsansatz ist in der zunehmenden Einführung sowie dem Ausbau öffentlicher Ganztagsbetreuung in Deutschland zu finden. Daher befasst sich die vorliegende Arbeit mit der folgenden Frage: „Ist die öffentliche Ganztagsbetreuung von Kindern ein adäquates Mittel, um die Kinderarmut in Deutschland einzudämmen?“
Hauptanliegen dieser Arbeit ist es, die Benachteiligungen in den unterschiedlichen Lebenslagen der von Armut betroffenen Kinder zu beleuchten und zu hinterfragen, inwieweit die öffentliche Ganztagsbetreuung in der Lage ist, diese Benachteiligungen
auszugleichen bzw. abzumildern. Die vorliegende Arbeit nähert sich diesem Thema, indem sie zunächst Definitionen anführt, die Ursachen und Folgen der Kinderarmut sowie die Aufgaben der Kindertagesstätte und der Ganztagsschule benennt.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Definition von Armut
2.1 Absolute und relative Armut
2.2 Lebenslagenansatz
3 Ursachen von Kinderarmut
3.1 Auflösung der klassischen Familie
3.2 Auflösung des Normalarbeitsverhältnisses
4 Folgen der Armut für Kinder
4.1 Gesundheitliche Auswirkungen der Armut auf die
4.2 Benachteiligung der Kinder im Bildungsverlauf
5 Öffentliche Ganztagsbetreuung
5.1 Aufgaben der Kindertagesstätte
5.2 Aufgaben der Ganztagsschule
6 Ganztagsbetreuung als Weg aus der Kinderarmut
7 Resümee
8 Quellenverzeichnis