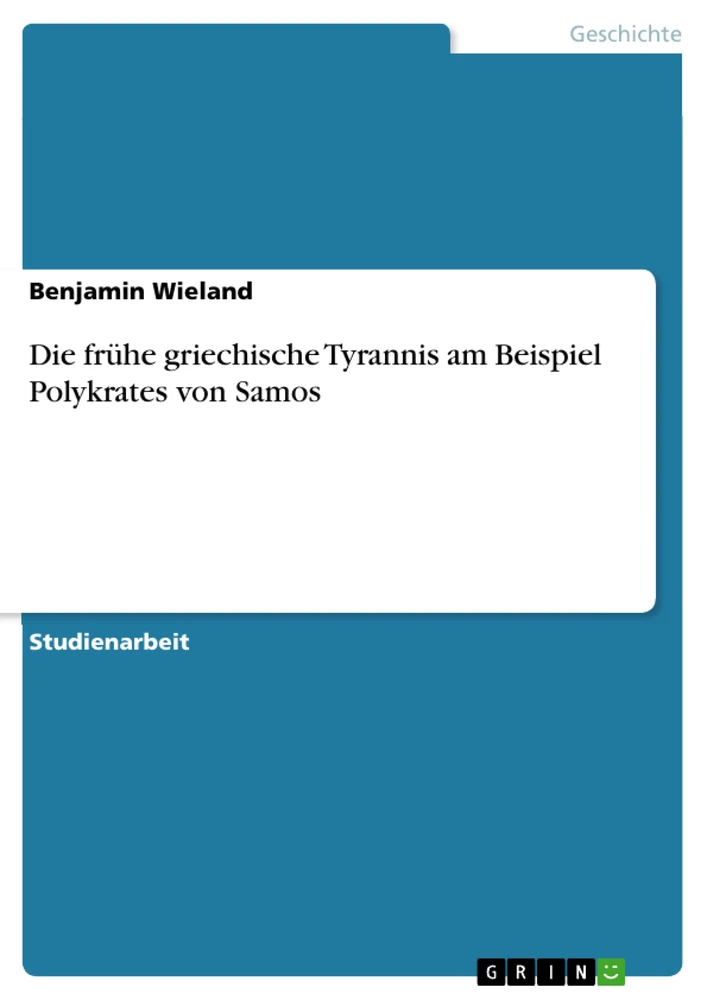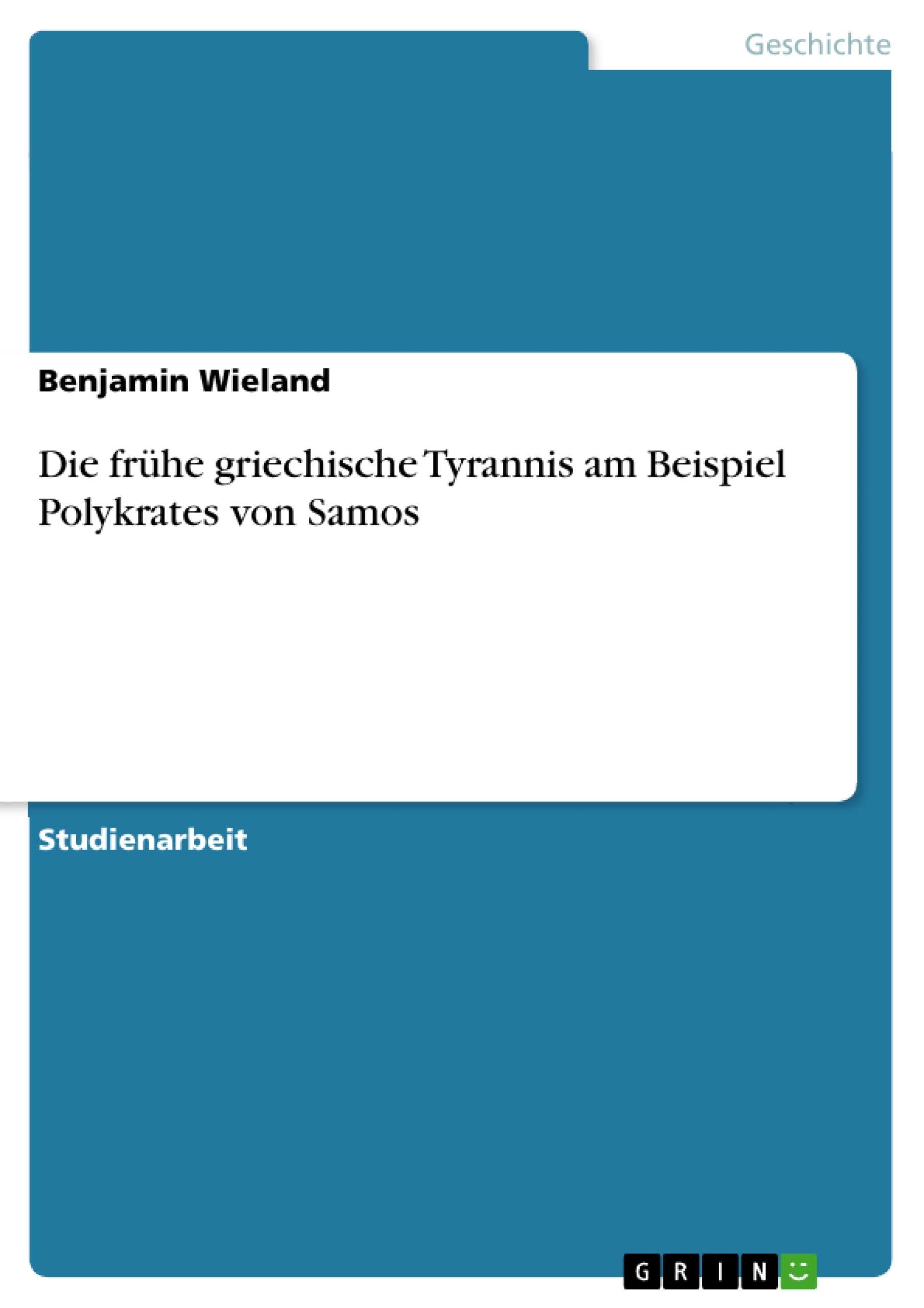Der generelle Charakter der frühen Tyrannis manifestiert sich in markanter Weise in der politischen Stellung des Tyrannen innerhalb der jeweiligen Polis. Schon für Aristoteles bestand das entscheidende Kriterium zur Differenzierung zwischen Tyrann, König und Gesetzgeber vor allem im Umgang mit den Bürgern der eigenen Polis und der innenpolitischen Situierung der jeweiligen Person.
Die Arbeit versucht daher, über die Gegenüberstellung des Tyrannendiskurses bis einschließlich Aristoteles mit den aktuellen Ergebnissen der historischen Forschung zur frühen Tyrannis die Position des Tyrannen innerhalb der aristokratischen Oberschicht genauer zu betrachten. Dabei soll mit Hilfe der Primärquellen sowie der maßgeblichen Sekundärliteratur ein vermeintlich genaueres und historisch fundierteres Bild der frühen Tyrannis gezeichnet werden, als es durch Aristoteles' Topik vermittelt wird. Als markantes Beispiel wird hierfür der Fall des Polykrates von Samos gewählt, der in exponierter Form gewissermaßen ein Idealbild des frühen Tyrannen abgibt.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1. Der Tyrannendiskurs bis Aristoteles
1.1. rvpavvog vor Aristoteles
1.2. rvpavvog bei Aristoteles - Zementierung des Begriffs
2. Tupa.vvtc Paoilsia und die archaische Lebenswelt
2.1. Das Problem
3. Das Beispiel Polykrates von Samos
3.1. Die Machtergreifung
3.2. Die Bauten
3.3. Die Maiandrios-Rede
Schlussbetrachtung
Quellen- und Literaturverzeichnis 28