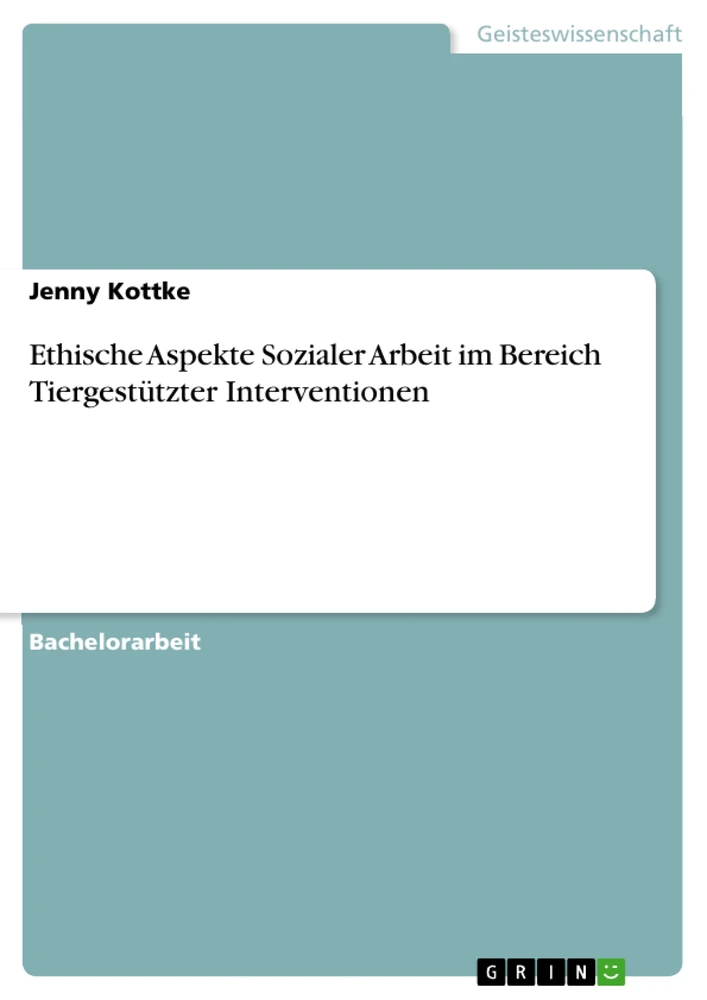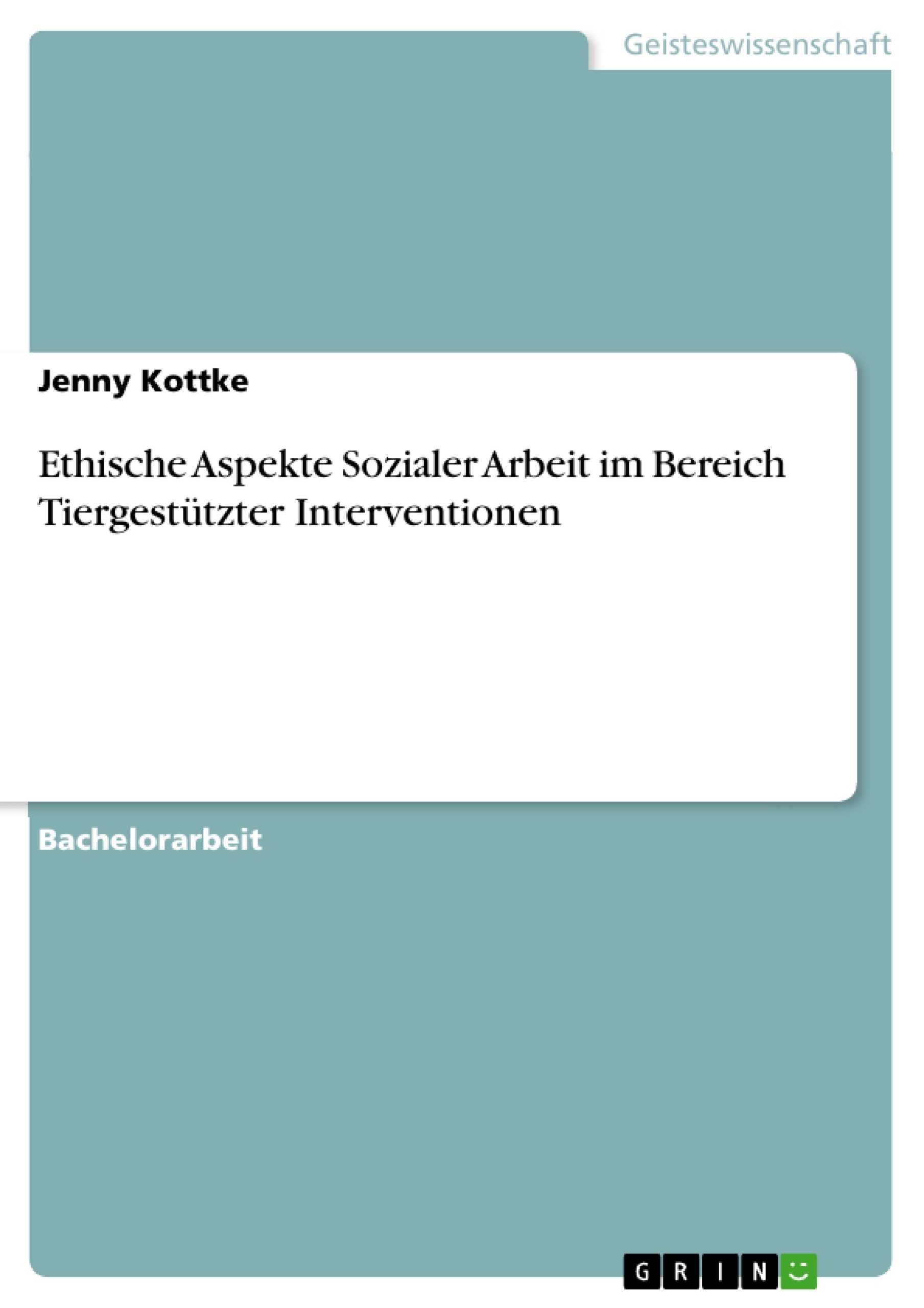Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wird versucht, das Konzept der tiergestützten Interventionen vorzustellen und die ethische Vertretbarkeit einer solchen Arbeit zu hinterfragen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Das Konzept tiergestützter Interventionen
2.1 Anfänge im anglo-amerikanischen Raum
2.2 Begriffsbestimmung Tiergestützte Intervention
2.2.1 Tiergestützte Aktivität
2.2.2 Tiergestützte Pädagogik
2.2.3 Tiergestützte Therapie
2.2.4 Mensch-Tier-Beziehung
2.2.4.1 Biophilie-Hypothese
2.2.4.2 Konzept der „Du-Evidenz“
2.2.4.3 Bindungstheorie
2.2.4.4 Spiegelneurone
2.3 Zusammenfassung des Konzepts
2.3.1 Zielgruppe
2.3.2 Praxisfelder
2.3.3 Wirkungseffekte
2.3.4 Methodische Ansätze
3. Ethische Grundproblematik tiergestützter Arbeit
3.1 Ethische Überlegungen
3.1.1 Definition Ethik
3.1.2 Zusammenleben von Mensch und Tier
3.1.3 Mitleidsethik
3.1.4 Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben
3.2 Ethische Aspekte Sozialer Arbeit im Allgemeinen
3.3 Voraussetzungen für ethisch vertretbare Nutzung von Tieren bei tiergestützter Arbeit
3.3.1 Gesetzliche Grundlage
3.3.2 Hygiene
3.3.3 Sozialkontakt und Bewegung
3.3.4 Nutzung versus Missbrauch
3.3.5 Bewertung von Befindlichkeiten
3.3.6 Instrumentalisierung von Tieren
3.4 Zusammenfassung
4. Kritisches Beispiel: Delfintherapie
4.1 Besonderheiten von Delfinen als „therapeutische Begleiter“
4.2 Forschungsprojekt „Delfintherapie“ an der Universität Würzburg
4.2.1 Aufbau der Therapie
4.2.2 Aufbau der Studie und Erkenntnisse
4.3 Delfintherapie in der Kritik
5. Analogie zu tiergestützter Arbeit mit Hunden
5.1 Der Hund als Begleiter des Menschen
5.2 Eignung des Hundes für TG I
5.3 Beispiel Behindertenbegleithunde
5.4 Zusammenfassung
6. Chancen tiergestützter Interventionen im Hinblick auf den Erfolg Sozialer Arbeit
6.1 Mitwirken und Chancen von Sozialarbeitern im Bereich der tiergestützten Interventionen
6.2 Vorteile
6.3 Nachteile
Fazit
Literaturverzeichnis