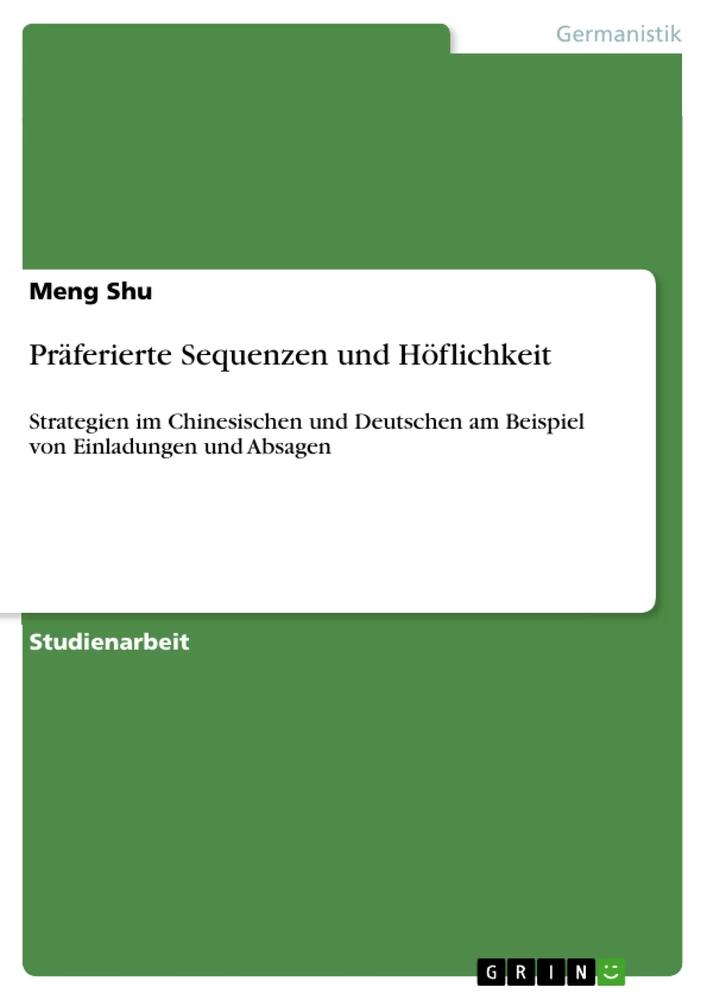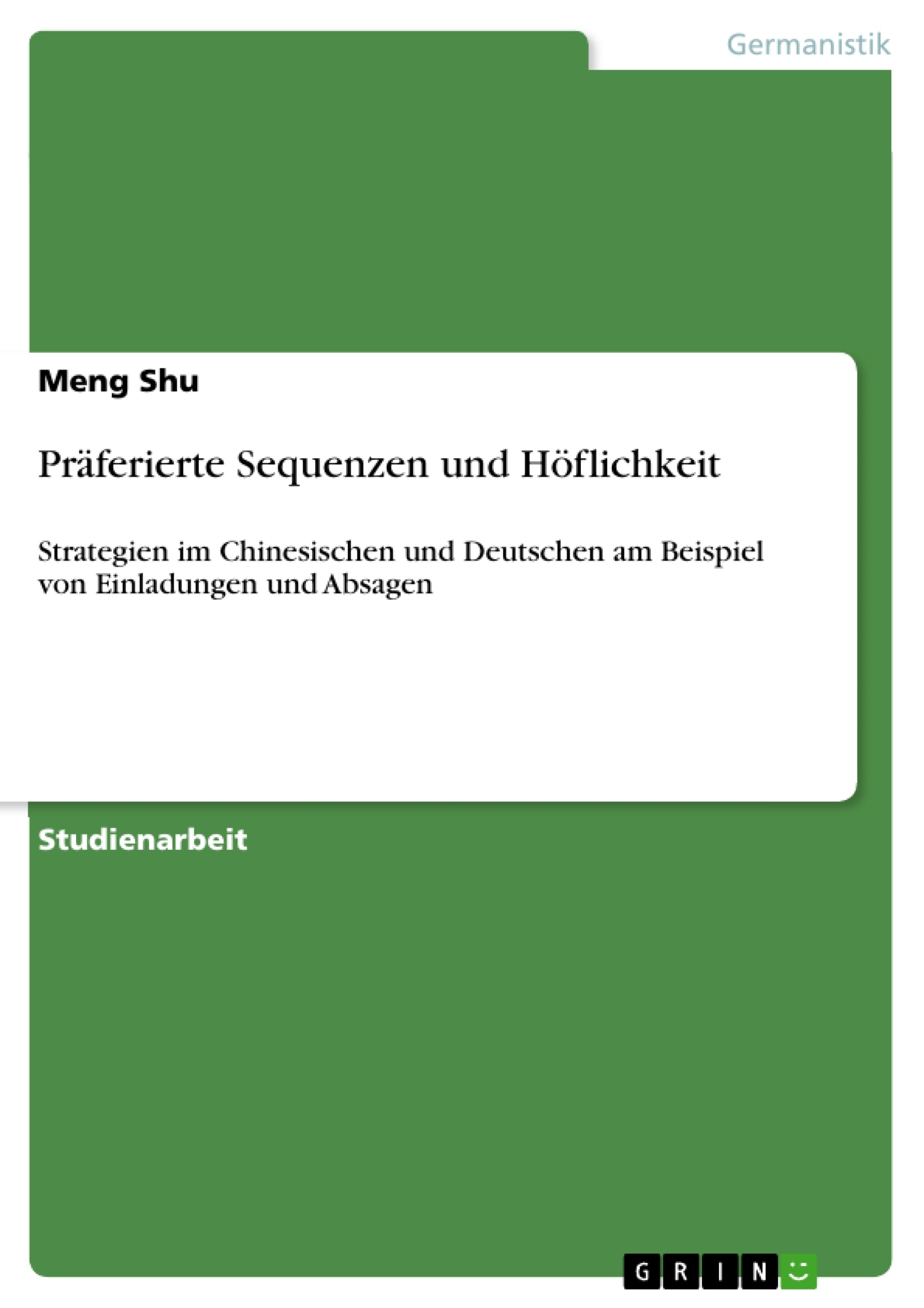China wird von uns Chinesen selber als „Land der Höflichkeit und Güte“ genannt. In China gibt es nämlich tausende Höflichkeitsformeln und Rituale, die auf uns von klein auf beeinflussen. Eine andere Denkweise ist, die Höflichkeitsformeln und Rituale, die sich mehr oder weniger von den westlichen Formeln unterscheidet, könnten zu Missverständnissen bei den interkulturellen Begegnungen führen. Deswegen scheint es bedeutend, Unterschiede der Höflichkeitsstrategien in kulturellen Ebenen zu vergleichen, um die Missverständnisse bei der interkulturellen Zusammenarbeit zu minimieren, vor allem anhand der Tendenz zur Globalisierung der Welt. In der vorliegenden Arbeit erläutere ich am Beispiel von Einladungen und Absagen die präferierte Sequenzen und die unterschiedlichen Höflichkeitsstrategien im Chinesischen und Deutschen. Nach Levinsons Theorie werden in der Konversationsanalyse Absagen nicht präferiert. Wer nicht in der Lage ist, anderem Gesicht zu geben, d. h., andere durch Handlungen oder Worte in unangenehme Situationen zu bringen, steht in der Gefahr, die sozialen Beziehungen zu beschädigen, etwa bei der Ablehnung einer Einladung. Um das gesichtsbedrohende Potenzial zu minimieren versuche die Interagierenden eine komplexere und längere Struktur bei der Artikulierung als auch bei der Formulierung im Vergleich mit einer Einladung. Nach der Theorie von Brown und Levinson schieben gern die Interagierenden, die die Einladung aussprechen, ihrer eigentlichen Einladung zum Beispiel eine Frage voraus, etwa, ob man am Wochenende schon etwas vorhabe. Adressaten von Einladungen wiederum äußern Zusagen direkt und nicht verzögert, während hingegen Absagen verzögert zum Beispiel Unterbrechung, Danksagungen, Mitigatoren von Typ „Ja gern, aber…“ sowie Gründe für die Absage formuliert werden, damit die Intergierenden das gesichtsbedrohende Potenzial minimieren, das die Ablehnung einer Einladung mit sich führt. [...]
Gliederung
1. Zielsetzung der Arbeit
2. Theoretischer Hintergrund
2.1 Begriffserklärung in der Konversationsanalyse
2.1.1 Das Konzept des Gesichts
2.1.2 Höflichkeitsstrategien nach Brown und Levinson
2.2 Vorstellungen von Respekt vor dem Anderen in China und Deutschland
2.3. Fragestellungen für die Arbeit
3. Vorgehen vom Gespräch-Experiment
3.1. Probanden
3.2. Design vom Experiment
4. Analyse der Gesprächssequenzen
4.1. Analyse der Gespräche mit Chinesen
4.1.1 Bei der Anrede:
4.1.2 Bei der Einladung
4.1.3 Bei dem Absagen
4.2. Experiment 2: 2 Gespräche mit Deutschen
4.3. Zusammenfassung der Ergebnisse
5. Diskussion der Ergebnisse: Höflichkeit im interkulturellen Vergleich
6. Zusammenfassung
Anhang: Experiment-Gespräche
Gespräch 1:
Gespräch 2:
Gespräch 3:
Gespräch 4:
Gespräch 5
Gespräch 6
Gespräch 7
Gespäch 8
LITERATURVERZEICHNIS