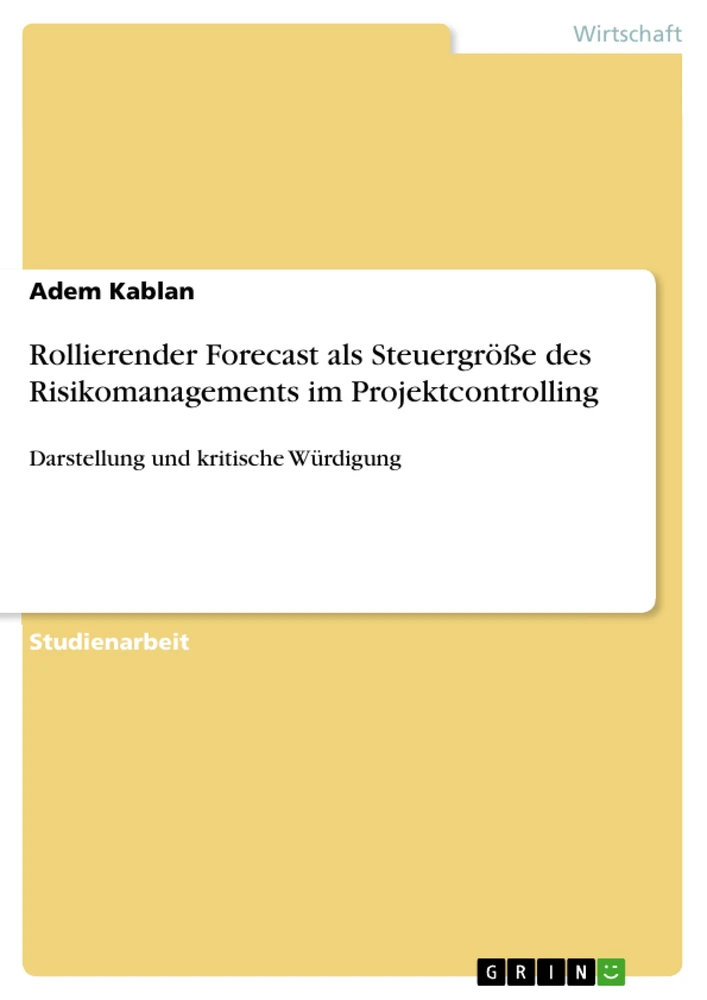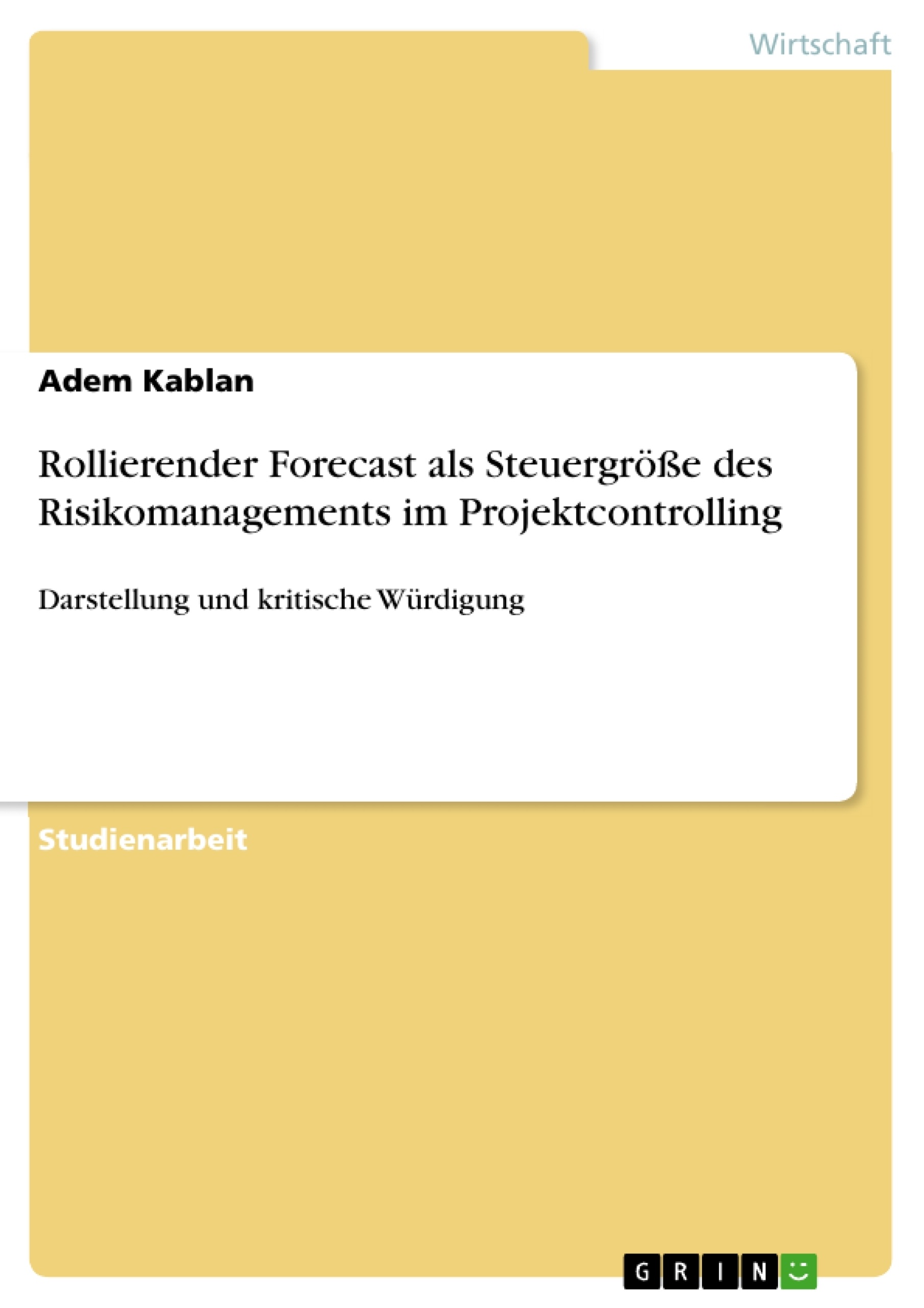[...] Das Ziel dieser Arbeit ist es darzustellen, wie mit dem rollierenden Forecast als Instrument aus der Budgetplanung heraus, das Risikomanagement in Projekten ausgeführt werden kann. Als Grundlagen dieser Arbeit werden in Kapitel 2.1 das Risikomanagement vorgestellt, und in Kapitel 2.2. die Aufgaben und Ziele des Projektcontrollings. Mit der Darstellung des Projektrisikos, im Zusammenhang mit der Projektplanung in Kapitel 2.3 werden die Grundlagen abgeschlossen. Im darauf folgenden Kapitel 3.1 wird die klassische Budgetplanung erläutert, um im Anschluss in Kapitel 3.2 neuere Budgetierungsansätze vorzustellen, die aus der Kritik der klassischen Planung entstanden sind. Kapitel 3.3 beinhaltet den rollierenden Forecast als Instrument der neueren Planungsansätze. Das nächste Kapitel 4.1 erklärt den Übergang vom rollierenden Forecast zur rollierenden Planung, um dann in Kapitel 4.2 die Rolle des rollierenden Forecast im Risikomanagement zu beschreiben. Die kritische Würdigung folgt im Kapitel 4.3. Im letzten 5. Kapitel sind eine Zusammenfassung und das Fazit der Aufgabenstellung zu finden.
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1. Einleitung
2. Grundlagen zum Risikomanagement und Projektcontrolling
2.1 Begriffsdefinition Risikomanagement
2.2 Aufgaben und Ziele des Projektcontrolling
2.3 Auswirkung des Projektrisikos auf die Projektplanung
3. Umbruch in der Budgetplanung
3.1 Die klassische Budgetplanung im Überblick
3.2 Moderne Budgetierungsansätze: beyond-, better-, advanced budgeting
3.3 Der rollierende Forecast als gemeinsames Element der modernen Budgetierungsansätze
4. Rollierender Forecast in der Projektplanung
4.1 Übergang vom rollierenden Forecast zur rollierenden Projektplanung
4.2 Risikomanagement durch rollierenden Forecast
4.3 Kritische Würdigung und Handelsempfehlung
5. Fazit
Literaturverzeichnis